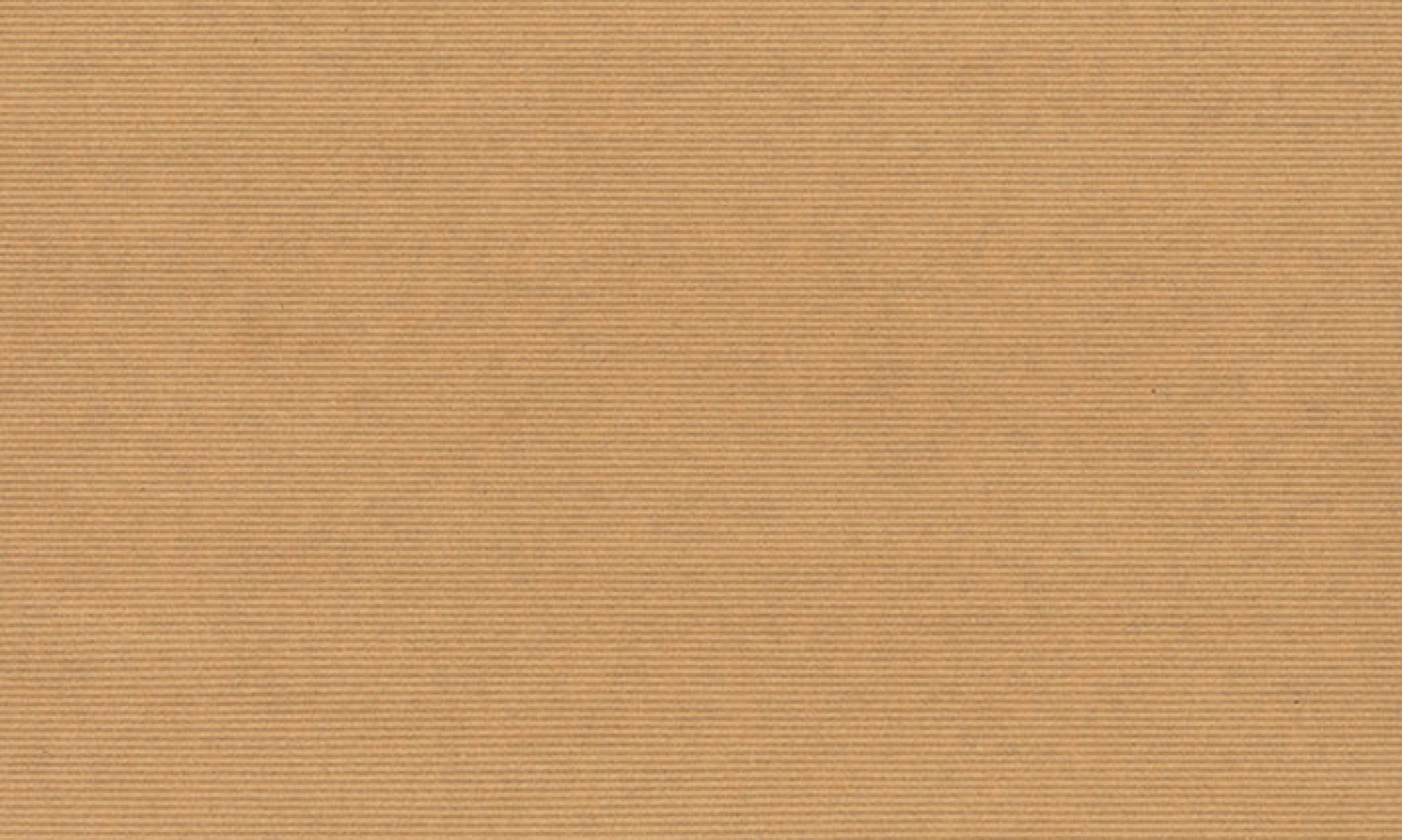Im folgenden Text möchte ich versuchen, der uns selbst gestellten Aufgabe der Reflexion des nunmehr beinahe 2 Jahre dauernden Projektes „Tricks of the Trade“ nachzukommen. Nun, zwei Jahre sind eine lange Zeit, viele Begegnungen sind geschehen; ich erinnere vielfältige Gespräche, Beobachtungen, emotionale Aufs und Abs, zu vielen neuen Namen habe ich jeweils fragmentierte Geschichten, Bilder, Töne. Jetzt scheint der Punkt gekommen dies alles auf eine neue Ebene zu heben, dieses Viele in Beziehung zu mir und meinem Tun zu setzen, einen Sinn daraus zu machen.
Wenn ich schreibe, dass wir uns gedacht haben, dass es eine gute Idee sein könnte, die von uns initiierten, erlebten, beobachteten, etc. Prozesse je individuell in einem bis zu 5 Seiten langen Text zu reflektieren und darüber zu versuchen geneigten LeserInnen einen Einblick in unser Verständnis selbiger zu geben, stellt sich die Frage, wer denn ‚wir‘ gemeint ist. Womit ich bei der hauptsächlichen Frage dieses Textes angelangt bin: Was verstehe ich (nach diesen 2 Jahren Projektarbeit) unter Partizipation bzw. genauer: unter der Methode der Participatory Action Research (PAR), die wir uns als Motto für unsere Herangehensweise gewählt haben.
Nochmal, Begegnungen sind reichhaltig und übersteigen letztlich jegliche (sich vollständig wähnende) Beschreibung, nichtsdestotrotz werden sie erlebt, können Teile in Sprache überführt, können sie erinnert und erzählt werden. Derartige Erzählungen beinhalten möglicherweise die Dimension des Gefühlten, sind angereichert mit Emotionalität, da sie weniger beobachtet als erlebt werden. Doch ich flüchte mich hier in pseudo-wissenschaftliche Sprache, auch das vielleicht ein Indiz dafür, dass diese Textsorte mir nicht ganz geheuer ist, zugleich aber wird dadurch auch deutlich, dass dies nicht der angemessene Ton für diese Form der Erzählung zu sein scheint – er ist stets um Distanzierung des Beforschten bemüht, hier geht es aber um die Involvierung, einen Distanzverlust. Zusammenfassend habe ich bislang folgendes angesprochen, das mich nun weiter beschäftigen wird:
Was verstehe ich unter PAR?
Wen umfasst ‚Wir‘?
Bedeutung von Nähe und Distanz zum Forschungsgegenstand?
Was/Wer ist der Forschungsgegenstand?
In den letzten zwei Jahren sind für mich sehr viele neue und interessante, teils auch aufregende und irritierende, Ereignisse innerhalb dieses Projektes möglich geworden.
Unsere Grundidee, wie wir mit den SchülerInnen und der Klassenlehrerin zusammenarbeiten möchten, war, sie in eine sozialwissenschaftlich geleitete Forschungsarbeit einzubeziehen und mit ihnen gemeinsam zu Themen ihrer Wahl zu forschen. Wenngleich uns bereits zu Beginn des Forschungsprozesses bewusst war, dass wir, im Hinblick auf andere uns zu diesem Zeitpunkt bekannte PAR-Studien, etwas Wesentliches vermissten, den Auftrag. ‚Normal‘ erscheint nach Lektüre solcher Publikationen, dass eine Personengruppe ein Problem definiert und nun ForscherInnen darauf aufmerksam macht, oder diese von allein (?) darauf aufmerksam werden – jedenfalls nun die ForscherInnen dieser oder diesen Personengruppe/n ihre wissenschaftliche Expertise zur Problemlösung anbieten. Daraus resultiert idealerweise ein gemeinsamer Forschungsprozess an dessen Ende eine robuste, weil sozial ausgehandelte, Problemlösung steht, die die Betroffenen gemeinsam mit den WissenschafterInnen entwickelt haben. Hier findet sich die Action in PAR.
Wir waren leider nicht in diesem Sinn erwunschen, wir sind einer Ausschreibung eines Ministeriums gefolgt, haben erfreulicherweise unseren Projektantrag bewilligt bekommen und somit ist uns diese Form der Forschung ermöglicht worden. Stolz ausgerüstet also ab in die Schule und Forschung machen? Nicht ganz. Freilich bedurfte es, nun da es ‚ernst‘ geworden war, eines Treffens mit der Lehrerin, einem konkreten Ausverhandeln der Semestergestaltung, wie viel und zu welcher Zeit wir in der Schule arbeiten können/dürfen. Zudem ein Hinweisen der Lehrerin auf die schwierigen und für uns vermutlich ungewohnten Schulbedingungen und -abläufe, da es sich um eine ehemalige Hauptschule (nun Kooperative Mittelschule) handelt, deren SchülerInnen, wie wir so gern sagen, aus sozial benachteiligten Haushalten stammen, teilweise Schwierigkeiten Deutsch zu sprechen haben, ihre Interessen und Probleme gänzlich anders gelagert seien, als wir sie mit unserem Motto: „Forschen wir gemeinsam“ ansprechen könnten. Dass die SchülerInnen momentan am Beginn ihrer Pubertät stünden bzw. manche, zu diesem Zeitpunkt vermutlich nur 2 SchülerInnen, da sie ein Jahr älter als ihre MitschülerInnen sind, sich bereits mittendrin in dieser etwas stürmischen Zeit befänden.
Das wollte uns alles nicht irritieren, ab in die Klasse. Endlich. Es folgte ein recht unebenes Semester, in dem wir viel ausprobierten, versuchten den SchülerInnen zu erklären was Wissenschaft ist, weshalb von Disziplinen gesprochen wird und was diese unterscheidet, aber auch was sie eben verbindet. Wir nutzten Vermittlungsformen, wie etwa das Rollenspiel, usw. und letztlich hatten wir sehr unterschiedliche Wahrnehmungen bezüglich Gelingen und Scheitern unserer Anliegen. Zugleich zeigte sich die Schwierigkeit von Kontinuität, einerseits bei der Frage, wie wir die SchülerInnen von einer Einheit zur nächsten ‚mitnehmen‘ können (zwischen diesen lagen meist 2 Wochen), andererseits, wie wir unsere eigenen Interessen und Fragen kontinuierlich verfolgen können (ganz zu schweigen davon, wie abzuschätzen ist, ob und welche Wirkungen ein jetzt gesetzter Input später haben mag). Bereits in der ersten Einheit wurde mir ein Grundproblem sehr deutlich, das in der Beobachtung als selektive Wahrnehmung diskutiert wird, sich bei uns aber ein klein wenig anders stellt. Hierbei handelt es sich um ein zwar zu reflektierendes, methodisch möglichst bearbeitbar zu machendes, aber letztlich nicht lösbares Problem des Ausschnitts, der fragmentierten, partiellen Beobachtbarkeit von Phänomenen. Was aber tun wenn sich Phänomene vor Phänomene schieben, wenn SchülerInnen beginnen mit mir zu sprechen, während eine Kollegin ihr Wort an alle Beteiligten richtet? Wenn die Phänomene keine Phänomene sondern Agenten sind, die, und das scheint mir hier die Besonderheit, mich immer wieder daran erinnern ein Teil dieser Situation zu sein, mich einbeziehen in ihre Wünsche, Sorgen, Probleme, etc.? Die Involvierung kam also lang bevor den Beziehungen die wir heute zueinander führen, doch ein Rückzug auf eine Beobachterposition, so sie mir überhaupt möglich gewesen wäre, hätte diese Beziehungen vielleicht unterbunden, der Forschungsgegenstand wäre möglicherweise dieserart erhalten, abgegrenzt geblieben.
Im zweiten Semester, nachdem uns einige SchülerInnen wissen ließen, dass sie das so ziemlich fad fänden, versuchten wir unsere Forschungsstrategien zu überarbeiten. Statt Großgruppe (gesamte Klasse, Sesselkreis und/oder Frontalunterricht) wurden Kleingruppen gebildet, Forschungsfragen und -themen von den SchülerInnen erhoben (mittels Einzelinterview, mittels Forschungsfragebox, in welche die SchülerInnen zu jeder Zeit anonym, so gewünscht, ihre Fragen einwerfen konnten) und diese schließlich von uns zu 4 Themen gefasst, die wir den SchülerInnen zur Auswahl stellten. Auf jede/n ForscherIn kamen nun im Schnitt 3 bis 4 SchülerInnen und ein einigermaßen eingegrenztes Forschungsthema – die Praxis sollte ab nun LehrmeisterIn sein. In sämtlichen dieser Kleingruppen gibt es Geschichten der Annäherung, der gegenseitigen Öffnung, einem Interesse am Gegenüber, der Etablierung eines gewissen Vertrauens und letztlich der Einbindung in das jeweils Andere. Das alles ist graduell zu verstehen, hier gibt es kein entweder/oder. Gleiches gilt für auftauchende Konflikte zwischen uns und den SchülerInnen, zwischen den SchülerInnen (entlang des Forschungsthemas), usw. Dringlichkeiten werden anders verteilt, die Forschungsarbeit modifiziert sich. Es scheint mir im Rückblick, dass sich hier erste Beziehungen zu einander entwickelten, die über die Forschungsarbeit in gewisser Weise hinausgingen. Weshalb habe ich diesen Eindruck und bedeutet das bereits Partizipation?
Positiv formuliert, fanden wir in den Themen – verkürzt – Liebe und Park, eine gemeinsame Ebene auf der sich sprechen, forschen, diskutieren ließ. Dabei verschwinden die Unterschiede zwischen uns und den SchülerInnen nicht, aber sie erscheinen zumindest temporär und teilweise überbrückbar. Ist das nun ein Lernverhältnis, auf das sich aufbauen lässt. Letztlich weiß ich das, wenigstens derzeit nicht sicher. Ich kann sagen, dass ich sehr viel gelernt habe über diese SchülerInnen, manche sind mir näher als andere, mit manchen gelingt das Gemeinsame ‚leichter‘ als mit Anderen, aber, wie bereits zu Beginn angemerkt, jeder dieser mir zu Beginn noch unbekannt und fremd wirkenden Namen (die merke ich mir nie) hat in mir wenigstens eine Geschichte assoziiert. Darüber hinaus, denke ich, hat uns das intensive gemeinsame Arbeiten und Forschen gezeigt wo wir Schwierigkeiten haben sozialwissenschaftliches Wissen zu übersetzen.
Nach dem 2. Semester wurde von mehreren Mädchen eine Radiosendung zu ihrem Thema gestaltet, mit der sie heute, ca. 1 Jahr danach recht unzufrieden sind – dies sei noch keine richtige Forschung gewesen, wie sie uns versichern. In diesem Argument fallen für mich verschiedene hypothetische und abgeleitete Gründe zusammen bzw. werden diese denkbar:
Sie sind jung und verändern sich stetig, was gestern cool war ist heute peinlich. Sie haben zu wenig Selbstvertrauen in ihr Tun, ihre Veräußerungen. Sie haben zu wenig Rückhalt von zuhause, von der Schule, von uns. Sie sind eitel. Sie haben damals nicht daran gedacht, dass diese Sendung dann für viele hörbar wird. Sie haben nicht gewusst, wie fremd sich die eigene Stimme als Aufnahme anhört. Sie haben gelernt, wie sie argumentieren müssen, damit wir es verstehen und gelten lassen. Sie haben ihre Ansichten über Forschen geändert, sie haben Forschen gelernt.
Zu gern würde ich nun als Ergebnis den letzten Punkt hervorheben, aber das wäre stark verkürzt und, aus einer bestimmten Perspektive, wäre es eben dann nicht Forschen und sie hätten nichts gelernt, wenn nicht all die anderen Motivationen, Barrieren, Möglichkeiten bestehen blieben. So fern des Alltags ist wissenschaftliches Arbeiten nicht.
Es folgte das 3. Semester, das aus Zeitgründen, aber auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen in eine Projektwoche konzentriert wurde. Damit konnten wir dem oben beschriebenen Kontinuitätsproblem etwas entgegenwirken. Die Arbeiten aus diesen Gruppen weisen meiner Meinung nach deutlich stärker in ein gemeinsames Forschen, das die SchülerInnen als solches nun auch besser für sich anzunehmen scheinen. Die SchülerInnen, wer sind sie, sind sie uns alle bis heute erhalten geblieben? Heute, meint die letzte Phase dieses Projektes, die Ergebnisaufbereitung und Publikation selbiger. Zu diesem Zweck haben wir uns für die Hervorbringung und Gestaltung einer Homepage entschieden. Die Gründe dafür sind vielfältig, ursprünglich dachten wir ein Buch zu machen, doch die Heterogenität der Materialien, der Beteiligten, die Kosten heutzutage ein Buch zu publizieren, usw. legten die Homepage näher, wenngleich hier letztlich freilich die gleichen Schwierigkeiten auftreten. Jedenfalls sind uns von ca. 16 SchülerInnen, die bei der Projektwoche dabei waren, ca. 3 bis 4, beim letzten Treffen sogar 7 SchülerInnen ‚geblieben‘, die außerhalb ihrer Schulzeit, in ihrer Freizeit mit uns an dieser Homepage arbeiten. Wir bieten ihnen dafür Essen und Büroräumlichkeiten und Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten an – eigentlich relativ wenig, wäre ich in diesem Alter einem solchen Angebot nachgekommen? Kann gut sein, denn in diesem Alter war ich froh über jeden ‚dritten‘ Raum abseits von Schule und Zuhause. Da wir die SchülerInnen ob ihres Alters jedes mal von der Schule abholen, ergeben sich viele der privateren Gespräche am Weg zum Büro, da dort angekommen, wieder die Zeitknappheit, die Arbeitsvorhaben regieren. Auf diesen Wegen habe ich mittlerweile über Liebe, FreundInnenschaft, Geschwister, Eltern, Schule, Bildung, Beruf, Politik, Xenophobie, Geld, Konsum, Sex, Drogen, Pubertät, Beziehungen beenden, Freizeitorte, Verhaltensweisen und Taktiken, etc. mit verschiedenen Jugendlichen gesprochen und möchte keinen dieser ‚Spaziergänge‘ missen. Zunehmend sind diese Gespräche aber auch in die Forschungsarbeit ‚hineingewachsen‘, so ist zumindest mein Eindruck. Waren sie zu Beginn Ablenkungen denen wir nachkommen wollten, aber nur begrenzt auch konnten, so haben diese mittlerweile ihre Orte und Zeiten zwischen uns (meist) gefunden. Dies mag sich auch daran zeigen, dass wir unsere Homepage zwar aufteilen werden zwischen unserer und der SchülerInnen-Forschung, die bestehenden SchülerInnen sich aber damit stärker um die generelle Gestaltung als auch ihre Inhalte (was wird wie gezeigt) kümmern.
Spätestens hier also doch eine Unterscheidung zwischen uns und ihnen? Wie können wir das rechtfertigen? Wir sind unterschiedlichen Institutionen mit verschiedenen Zielen und Anforderungen unterstellt, wäre eine ganz plausible Erklärung. Unterschiedliche LeserInnenschaften (mit Ersterem verbunden) eine andere. Ist das nun alles Wissenschaft? Wir wissen es noch nicht? Damit leite ich zu einer von zwei (klarerweise gibt es noch weit mehr) Leerstellen über die ich noch ansprechen möchte. Was ist mit der Analyse der Datenmaterialien? Ah, da ist noch eine dritte – das Datenmaterial, und damit eine vierte: der selbstreflexive Zugang. Es wuchert also wild unter der Oberfläche. Von hinten nach vorn. Der selbstreflexive Zugang spiegelt sich eben an der Struktur der Homepage wieder, denn wir wollen zugleich mit den SchülerInnen forschen und etwas über das Forschen mit diesen SchülerInnen aussagen. Zudem sind freilich Rahmenbedingungen, Schulorganisation, soziale Herkunft, Migration, Gender, usf. Zu berücksichtigen und zu beschreiben. Die erlebten Rollenkonflikte, vereinfacht das Zusammenfallen von ForscherIn (=BeobachterIn) und VermittlerIn, und diesbezüglich wiederkehrende teaminterne Diskussionen verweisen ebenfalls auf die Schwierigkeiten dieses Ansatzes. Das daraus resultierende Datenmaterial in Form von Protokollen (es gibt auch Audioaufnahmen, Plakate, etc. aber um diesen Punkt zu machen genügen beispielhaft die Protokolle) erzählt ebenfalls dieses Zusammenfallen unterschiedlicher Anforderungen. Ein Beobachtungsprotokoll zeichnet der möglichst weitgehende Verzicht auf Interpretationen aus, ebenso wie das ein beobachtetes Ereignis im Moment der Beobachtung bzw. unmittelbar danach notiert, festgehalten wird. Eine solche Beschreibung könnte sich etwa derart lesen: Ein Schüler, 3. Reihe neben dem Fenster, zeigt auf. Die LehrerIn erteilt ihm das Wort und er fragt ob er aufs Klo gehen dürfe, was sie ihm erlaubt. Sie ruft ihm nach: „Aber trödel nicht, du warst heute eh bereits mehrmals.“ Unsere Protokolle hingegen, verhalten sich hierzu verschieden. Sie sind stets erst im Nachhinein entstanden, in der Erinnerung, nachdem die gesamte Einheit, manchmal auch der gesamte Tag vorüber waren. Selten waren wir aber überhaupt in der Situation eine solche Perspektive, wie oben beschrieben, einzunehmen. Vielmehr waren es wir, an die die Bitte des Klogehens herangetragen wurde, möglicherweise hatten wir ebenfalls ob der Häufigkeit den Eindruck, dass es dabei noch um etwas anderes geht. Zumal wir in der Schule, in der Klasse standen – was würde seine LehrerIn sagen? Konflikte, Emotionen, Euphorie und Frustrationen, gemischt mit beobachtungsähnlichen Erzählungsabläufen stellen unser Datenmaterial dar. Ich denke, es führt nicht weit, sich allzu sehr über die Güte des Materials den Kopf zu zerbrechen, es ist das was wir haben, es bezieht sich auf eine bestimmte, in bestimmter Weise erlebte Wirklichkeit und versucht eben diese, ausgehende von diesen fixierten Eindrücken, Gedanken ausgehend zu rekonstruieren. Allerdings ist die Qualität deutlich eine andere, womit ich also nicht meine, dass es egal ist, von welcher Qualität das Datenmaterial ist, diese ist in jeder weiteren Auseinandersetzung mit dem Material zu berücksichtigen. Womit ich endlich bei der Frage nach der Analyse angekommen bin. Diese Arbeit ist intensiv und langwierig und daher in diesem Zusammenhang problematisch. Wir haben in den letzen Monaten sehr viel diesbezüglich hinzugelernt, wie ich meine. Viele Varianten haben sich als Einstieg für die SchülerInnen als kaum nachvollziehbar herausgestellt, keine ist voraussetzungslos, aber manche, wie die bereits erwähnte Beobachtung, erscheinen relativ transparent, in dem Sinn, dass die einzelnen Schritte und Übersetzungen bei entsprechend vorhandener Zeit und Betreuung gut dargestellt und also von den SchülerInnen als Praxis nachvollzogen werden können. Es gibt wenige ‚black boxes‘. Unsere eigenen Analysen haben diesbezüglich etwas an ihrem Zeitbudget eingebüßt bzw. haben sie sich teils aufgrund je aktueller Dringlichkeiten verzögert, verdichtet, etc. Wir sind noch mitten drinnen. Gleichzeitig ist jeder weitere Termin mit den SchülerInnen auch potentieller Generator neuer Datenmaterialien für eine möglichst angemessene Beschreibung und wiederum Analyse dieser Vorgänge. Erneut sind Zeitmangel, Rollenkonflikte, geteilte und vervielfachte Aufmerksamkeiten als Erschwernisse zu beobachten.
Womit ich zur zweiten wesentlichen Leerstelle komme, der Lehrerin. Wieso ist sie nicht bereits früher in diesem Text angesprochen, hatten wir nicht vor mit allen, also auch und im Besonderen mit der Lehrerin zu forschen? Ja, das hatten wir vor. Wir organisierten Treffen zwischen uns, aßen gemeinsam zu Abend, hatten witzige, interessante, spannenden Unterhaltungen, aber in gewisser Weise blieb stets ein unüberbrückbar erscheinender Abstand. Derzeit neige ich der Erklärung zu (die noch einer systematischen Analyse bedürfte), dass die Lehrerin ähnliches erwartet hätte, wie uns, dass sie aber im Gegensatz zu uns nicht die Ressourcen für eine solche Form des Einlassens zur Verfügung gestellt bekommt, sondern dafür die schulisch formulierten Anforderungen an ihre Klasse, ihre SchülerInnen zu übersetzen. Autorität, Integrität, Verantwortung, bestehende Konflikte zwischen SchülerInnen und einiges mehr, erschweren ein derartiges riskieren der einigermaßen stabilisierten Rolle im Klassenzusammenhang, ebenso wie in Richtung Schulleitung und/oder Erziehungsberechtigten. Was ist der persönliche Handlungsspielraum, welchen bietet die Rolle der Lehrerin? Welche Anforderungen werden an sie gestellt, welche Mittel ihr zur Durchsetzung in die Hand gegeben? Meine eigene Ambivalenz gegenüber Schule im allgemeinen (Militär und Kloster als die zur Verdeutlichung anzugebenden Extremfälle) ebenso wie gegenüber hervorgehobenen Lehrpersonen wurden in dieser Zeit wieder spürbar. Doch Schüler bin ich keiner mehr und so entstand auch hier eine Art 3. Position, einigermaßen empathisch (hoffe ich) gegenüber SchülerInnen wie auch der Lehrerin, aber in gewisser Weise stets auch ein wenig fremd/befremdet bleibend, ob der anderen ‚Notwendigkeiten‘ des Gegenübers. Problematisch daran ist allerdings, apropos ‚Notwendigkeiten‘, wiederum: wo bleibt die Action? Haben wir PAR mit der Darstellung unserer Ergebnisse, Forschungsprozesse in Form einer Homepage bereits Genüge getan? Wäre da nicht mehr möglich (gewesen)?
Das führt mich zu einer Frage, die mich ebenfalls ziemlich seit Beginn durch das Projekt begleitet hat: Warum Soziologie/ Sozialwissenschaften in Form einer angeleiteten Forschungspraxis an die Schule bringen? Was hat diese Wissens(generierungs)form, haben wir den dortigen SchülerInnen, LehrerInnen und sonst irgendwie Beteiligten diesbezüglich anzubieten?
Ich denke, dass eine sozialwissenschaftliche Herangehensweise andere Perspektive/n auf ‚die Welt‘ vermitteln, neues Wissen oder die (stetige bzw. auf Dauer gestellte) Arbeit hinter bereits Gewusstem, etc. zeigen kann; sie prinzipiell durch ihre Methoden, ihre Praxis besondere Fragen an ‚die‘ Welt stellt und mit darauf gegebenen ‚Antworten‘ einen spezifischen Umgang vorschlägt, tatsächlich zugleich eine andere Form der Weltbeziehung, wie auch der Auseinandersetzung mit der eigenen Wirklichkeit, dem alltäglichen Tun ermöglichen kann. Die Einnahme einer forschenden Perspektive bedeutet auch, die eigenen Kategorien, unhinterfragten Beurteilungsroutinen sich selbst bewusst zu machen, um mich dem ‚Anderen‘, seinen/ihren Ordnungsprozessen, Zuschreibungen, etc. möglichst vorurteilsfrei annähern zu können, indem die eigenen Kategorien und Routinen der Ordnung, Normalisierung, Bewertung möglichst ausgesetzt wird. Aus meinen eigenen Beobachtungen, erscheint mir ein solcher Zugang als eine Chance innerhalb der Schule im Allgemeinen, neben dem zu vermittelnden Faktenwissen, Wissens- und Frageformen zu vermitteln, in deren Fokus die Herstellung und Generierung eben solcher Fakten und deren sozialer Bedeutung/en stehen. Die Jugendlichen, wie auch die LehrerInnen sind in ihrem Alltag stetig konfrontiert mit Abgrenzungen, Zusammenschlüssen, Zugehörigkeiten und Ausschlüssen, dem Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe/Kollektiv, Fragen der Identität, Formen der Einteilung, der Bewertung, usw. Das ist nicht alles, aber ich denke, wir können zeigen, wie diese alltäglichen Routinen Platz greifen und die geteilte Wirklichkeit prägen. Zugleich scheinen eben diese einigermaßen ’soziologisierten‘ Begriffe, zumindest als Dimensionen in vielen der Fragen seitens der SchülerInnen enthalten. Beispielhaft: Für ein Mädchen, so erzählt sie einmal, sei es schwierig sich einem Burschen anzunähern, den sie mag, aber der kleiner ist als sie. Bei Beiden (wenngleich ich seine Position nicht kenne, aber es ist ja auch ein Beispiel) scheint die Sorge, die eigene, innerhalb der Schule mühsam erarbeitete Identität mit einer solchen für Andere sichtbare werdende Zuwendung, zu riskieren, im Zentrum zu stehen. Es wäre vermessen hier Revolutionen zu erwarten und dennoch erlaubt die sozialwissenschaftliche Herangehensweise von der ich spreche, soziale Ordnungskategorien wie Alter, Geschlecht (ja, vielleicht auch die Heteronormativität) auf ihre Tragfähigkeit für das eigene Leben hin abzuklopfen. Wir können deren Genese und Relativität ergründen, ihre Stabilisierung und Gewalt nachverfolgen und möglicherweise auf dieser Basis neue Allianzen gründen, andere Orte und Gruppen finden, usw. Und hierin liegt, meiner derzeitigen Meinung nach, das – zugegeben (oder hoffentlich) recht bescheidene – Emanzipationspotential dieses Zugangs, indem Handlungsspielräume ebenso wie Räume des vermindert riskanten Austauschs eröffnet werden können, die Action also.
Wir betreten damit endlich das unebene Terrain von Interpretation, Analyse und schließlich Rückführung selbiger in das wissenschaftliche ‚System‘, in Form der Publikation, um das wir uns derzeit noch mit einigen der teilnehmenden SchülerInnen bemühen. Nicht allen ist es möglich oder auch der Aufwand wert, in ihrer Freizeit an unseren Treffen zur Gestaltung der gemeinsamen Homepage teilzunehmen. Gelingende Analysen sowie Bindung der TeilnehmerInnen, der Ko-ForscherInnen, sind also (in Kontrastierung zu Fällen des Scheiterns) Themen, denen wir uns in unseren Analysen des Projektprozessverlaufs wohl noch zuwenden sollten.
Damit möchte ich zum Schluss und auf meine ersten beiden Fragen zu Beginn zurück kommen.
Was verstehe ich unter PAR? und Wen umfasst ‚Wir‘?
Beides lässt sich momentan nicht definieren. Ich denke aber, dass Partizipation eine Entscheidung seitens ‚der‘ Wissenschaft ist. Sie ist keine Revolution. Die Unterschiede, Vielfältigkeiten, Probleme, Sorgen, Rollen, Notwendigkeiten, Überzeugungen, Glaube, Werte, etc. aller Beteiligten bleiben (meist) hartnäckig und bestehen. Aber wir können ins Gespräch miteinander kommen, können unsere Ordnungsvorstellungen und -kategorien einander mitteilen, versuchen um sie zu werben, indem wir sie ein Stück weit praktisch nachvollziehbar machen, ihre Chancen und Grenzen aufzeigen und sie damit bis zu einem gewissen Grad auch riskieren, dass sie an anderen Wirklichkeiten zerbricht. Womit für mich ein Lernen der Wissenschaften durch Partizipation, Teilnahme an der Welt, angesprochen ist.
Das ‚Wir‘ erscheint dabei als ein Flüchtiges, Fließendes, stets Partielles, Fragmentiertes: Wir: die forschende Kleingruppe, Wir: das Projektteam bei internen Besprechungen, Wir: ForscherInnen und Lehrerin tauschen uns beim Abendessen aus, Wir: ein paar FreundInnen innerhalb der Klasse, Wir: die Klasse, Wir: eine Türkin und eine Bosnierin sind FreundInnen, Wir: grenzen uns von denen dort ab, Wir: verstehen nicht was die dort machen, Wir: ein Schüler und ich plaudern über unsere Berufsvorstellungen, Wir: die WissenschafterInnen, Wir: ein Projekt in Sparkling Science, usw. Welche Handlungsmöglichkeiten und -barrieren, Ein- und Ausschlüsse, Wissensformen (Geschichte(n), Zukünfte, Wünsche, Fakten, Ordnungskategorien, etc.), Beziehungen und schließlich Praxen diese Konstellationen jeweils und zueinander hervorbringen, dem gilt diesbezüglich mein Interesse.