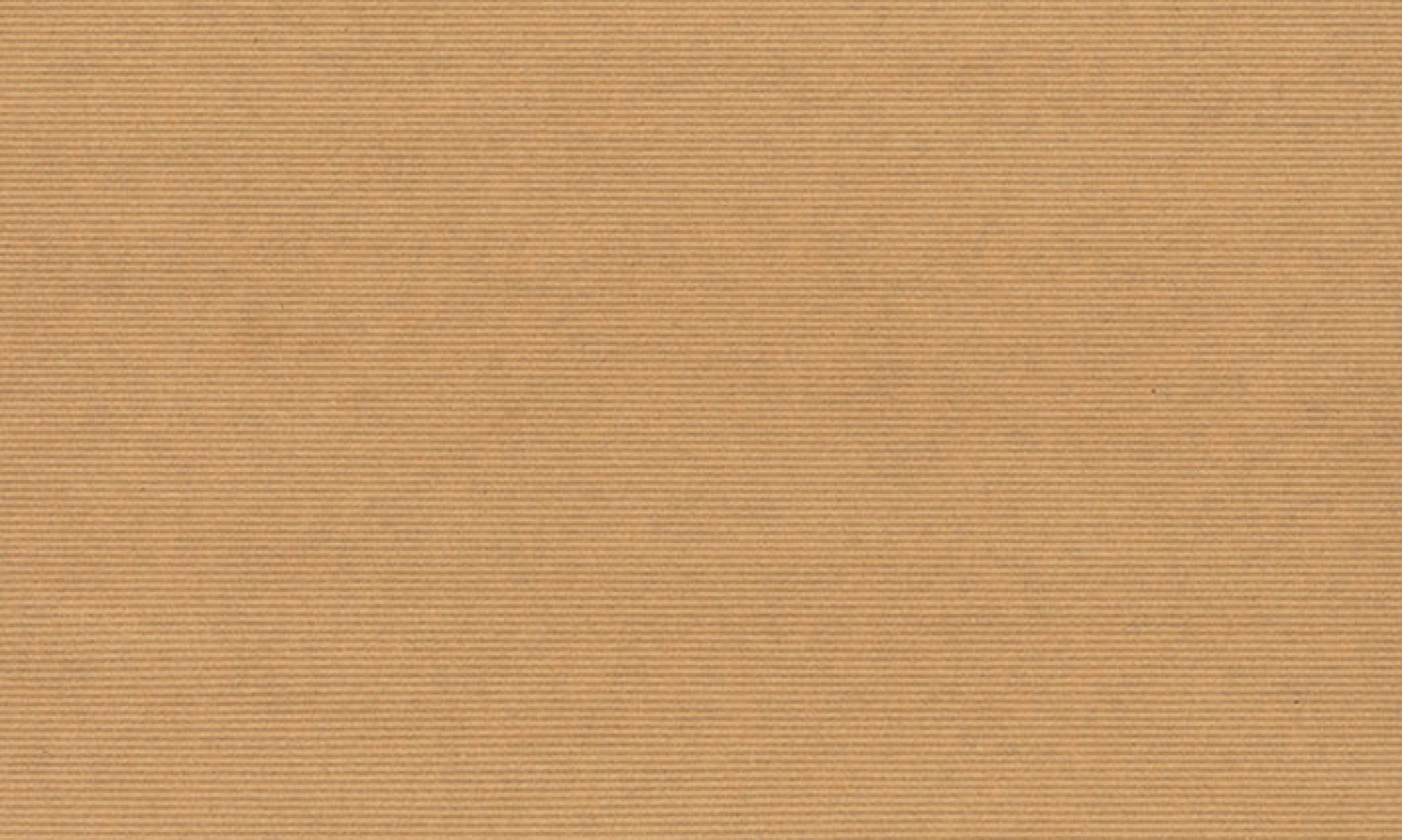Veronika Wöhrer
Eine wichtige Frage, die vermutlich alle Beteiligten begleitet, wenn Schule und Wissenschaft sich zu dem Zweck begegnen, dass Schüler_innen „Forschung“ machen, ist die, was Forschung eigentlich ist bzw. was unter Forschung verstanden wird: Wie wird Forschung von wem definiert bzw. welche (mitunter auch unterschiedlichen) Begriffe haben die beteiligten Personen von Forschung, Wissenschaft und Wissen?
Wie viele Vertreter_innen des „teacher research“ bzw. der Aktionsforschung in der Schule betonen, sind pädagogische und ‚forscherische‘ Perspektiven nicht unähnlich: beide basieren auf Neugierde und einem Wunsch zu lernen, beide ermuntern zu eigenständigem Denken, etc. (Wilson 1995; Baumann 1996; Noffke/Somekh 2008). Diese Perspektiven in der konkreten Arbeit eines/einer forschenden Lehrer_in zu verbinden ist jedoch nicht immer einfach oder widerspruchsfrei: E. David Wong betont, die sich teilweise widersprechenden Prioritäten in der Ausübung dieser Tätigkeiten: Er schildert seinen Zwiespalt entweder einer einzelnen Schülerin sehr viel Raum dafür geben zu können, ihre Antwort zu formulieren und zu reformulieren, um ihren Erkenntnisprozess gut dokumentieren zu können, oder allen in der Klasse gleichberechtigt Raum für ihre Versuche einer Antwort geben zu können (Wong 1995). James F. Baumann beschreibt zeitliche und organisatorische Widersprüche – er hatte beispielsweise manchmal keine Zeit zu Forschungstreffen zu gehen, weil er für die Nachmittagsbetreuung der Schüler_innen eingeteilt war – die er immer zugunsten seiner Rolle als Lehrer entschied (Baumann 1996). Solche Differenzen und Widersprüche werden naheliegender Weise komplexer, wenn unterschiedliche Akteur_innen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Praktiken und Zielen aufeinander treffen.
Unsere Erfahrung als ausgebildete Sozialforscher_innen, die in die Schule kommen und dort Sozialwissenschaften vermittelnd forschen oder auch forschend Sozialwissenschaften vermitteln (diese beiden Versionen waren oft nicht zu trennen) war die, dass in der Schule und in der Wissenschaft mitunter sehr unterschiedliche Vorstellungen davon herrschen, was Forschung und Wissenschaft sind. So lösten beispielsweise euphorische Erzählungen der Wissenschafter_innen über Aussagen und neue Erkenntnisse der Schüler_innen bei den Lehrer_innen manchmal weit größere Skepsis aus – sowohl in Bezug darauf, ob das hier Gesagte wirklich so interessant sei als auch darüber, ob diese neuen Erkenntnisse den Schüler_innen in ihrer weiteren Bildungskarriere wohl noch viel nützen würden. Vor dem Hintergrund gemeinsamer Erlebnisse und Diskussionen versucht dieser Text nun aus der Sicht einer Sozialwissenschafterin zu beschreiben, was Forschung sein kann.1
Sozialforschung und Forschungsparadigmen
In der Wissenschaft gibt es verschiedene so genannte „Paradigmen“ (also in etwa: „wissenschaftliche Schulen“ oder „Herangehensweisen“), die sich in ihrem Verständnis davon, was gute Forschung ausmacht nicht unbedingt einig sind. Ein bis heute in der Wissenschaft dominantes Paradigma ist das der „positivistischen Wissenschaft“, es besagt dass Wissenschaft universell gültig sei, wertfrei und objektiv sein solle. Letzteres bedeutet, dass ein Ergebnis so zustande gekommen sein soll, dass jede andere Person unter gleichen Umständen zu dem gleichen Ergebnis kommen würde.
In der Sozialforschung wird dieses Paradigma oft in der so genannten „quantitativen Sozialforschung“ vertreten. Diese arbeitet, wie der Name sagt, mit gut quantifizierbaren Daten, d.h. zumeist mit standardisierten Fragebögen und statistischen Verfahren, in denen der Einfluss eines/r einzelnen Forscher_in in der „Datenerhebung“ (d.h. z.B. dabei ein Interview zu führen) sowie in der „Datenanalyse“ (z.B. die Antworten zu interpretieren) möglichst gering sein soll. In dieser Form der Forschung wird „deduktiv“ vorgegangen, d.h. „vom Allgemeinen zum Besonderen schließend“. Dabei geht der/die Forscher_in zunächst von einer so genannten „Hypothese“ aus, das ist eine Vermutung über einen Zusammenhang (z.B. Frauen verdienen schlechter als Männer, auch wenn sie gleich ausgebildet sind) und formuliert eine Forschungsfrage, mit der er/sie diesen Zusammenhang überprüfen kann (z.B. Verdienen Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen, wenn diese in der gleichen Branche tätig sind und die gleiche Ausbildung haben?). Dann wird versucht diese Frage zu „operationalisieren“, d.h. bearbeitbar zu machen. Der/die Forscher_in überlegt sich also, wen und was er/sie konkret wie untersuchen muss, um diese Frage beantworten zu können (z.B. einige Betriebe einer bestimmten Wirtschaftsbrache auswählen und eine Stichprobe von weiblichen und männlichen Angestellten des mittleren Managements zusammenstellen, die nach ihrem Einkommen befragt werden. Diese Antworten werden dann mit ihren Lebensläufen und ihren Arbeitserfahrungen verglichen.).
In der quantitativen Sozialforschung sind Repräsentativität, Reliabilität und Validität die zentralen Gütekriterien für wissenschaftliche Forschung.
Repräsentativität bedeutet, dass die Ergebnisse, die ich in einer kleineren Gruppe von Personen herausgefunden habe, auch wirklich auf die ganze „Grundgesamtheit“ der Bevölkerung, für die die Fragestellung formuliert war, übertragbar ist. Ein klassisches Beispiel dafür sind die Wahlhochrechnungen: Hier muss anhand der Ergebnisse von wenigen Wahllokalen, die früher geschlossen und ausgezählt wurden und mithilfe von Interviews auf die Gesamtheit der wahlberechtigten Bevölkerung Österreichs geschlossen und hochgerechnet werden.
Reliabilität (oder „Zuverlässigkeit“) bedeutet, dass eine Untersuchung unter gleichen Bedingungen auch von einer/m anderen Forscher_in zu den gleichen Ergebnissen führen muss. Angestrebt wird also die Wiederholbarkeit der Ergebnisse unter gleichen Bedingungen. Dies ist nahe liegender Weise bei standardisierten Fragebögen oder statistischen Berechnungen leichter gegeben als bei sogenannten „interpretativen Verfahren“, die weiter unten beschrieben werden.
Unter Validität (oder „Gültigkeit“) wird verstanden, dass Methode und Untersuchungsanordnung daraufhin überprüft werden müssen, ob sie auch das messen, was gemessen werden soll. Hier geht es also darum, ob eine Forschungsmethode zur Forschungsfrage passt. So kann ich im oben genannten Beispiel einer Untersuchung über gleiche oder ungleiche Löhne von Männern und Frauen diese zwar in Interviews nach ihrem monatlichen Einkommen fragen, wenn ich dies aber als einzige Datenquelle heranziehe ohne andere Daten wie beispielsweise Aussagen des Vorgesetzten, Lohnzettel, etc. ebenfalls zu erheben, werde ich nur sehr lückenhafte und ungenaue Informationen erhalten, auf deren Basis wohl kaum aussagekräftige Ergebnisse errechnet werden können.
In der qualitativen Sozialforschung oder auch dem „interpretativen Paradigma“, wird hingegen ein anderer Ansatz vertreten: Es wird davon ausgegangen, dass Forschung immer subjektiv ist und nie völlig wertneutral sein kann, dass es aber darauf ankommt, bewusst und selbstreflexiv damit umzugehen. Qualitative Sozialforschung funktioniert „explorativ“, d.h. es werden keine bestehenden Hypothesen geprüft, sondern es soll etwas herausgefunden werden, von dem mensch noch nichts weiß. Hier werden also an konkreten Beispielen eines Ausschnitts der sozialen Welt (z.B. einer Schulklasse) bestimmte Zusammenhänge herausgearbeitet und dann erst Hypothesen darüber gebildet, ob und inwiefern das auch für andere Zusammenhänge zutreffend sein könnte. In qualitativen Forschungen werden Forschungsfragen oft recht breit gestellt, um möglichst offen an das Forschungsfeld heranzugehen. Konkretere Fragestellungen werden erst im Laufe der Forschungstätigkeit formuliert.
Qualitative Sozialforschung hat auch andere Richtlinien. Der Soziologe Siegfried Lamnek (2005) nennt beispielsweise: Offenheit, Kommunikation, prozessorientierter Forschungscharakter, Reflexivität, Explikation, und Flexibilität.
Wichtig ist dabei vor allem, dass die Personen im Forschungsfeld mit ihrem Wissen und ihren Interpretationen ihrer sozialen Realität ernst genommen werden. Sie werden nicht primär als Datenlieferant_innen, sondern als Expert_innen ihrer Lebenswelt verstanden. Qualitativ arbeitende Forscher_innen sollen möglichst offen für Unvorhergesehenes sein und ihre Methoden den Anforderungen des Feldes anpassen. Es wird anerkannt, dass Interaktionen und Analysen in einem Forschungsprozess notwendigerweise subjektiv sind. D.h. Forschungssituationen sind nicht in diesem Sinne von anderen Personen wiederholbar. Es soll aber genau dokumentiert werden, wie der/die Forscher_in zu ihren Ergebnissen gekommen ist, sodass sie von anderen nachvollzogen (oder angezweifelt) werden können.
Es wird davon ausgegangen, dass sich Einzelfälle reflexiv auf die Gesamtgesellschaft beziehen, d.h. konkret, dass sich in jeder Situation und Interaktion Muster und Strukturen zeigen, die auf gesamtgesellschaftliche Regeln verweisen. So können also anhand einzelner Fälle und kleiner Felder Muster aufgezeigt werden, die mitunter Wesentliches über die Gesamtgesellschaft aussagen. Zudem wird beachtet, dass die erhobenen und analysierten Daten einen momentanen Zustand eines Feldes beschreiben, dieses aber seinerseits nicht statisch ist und sich also selbst weiterentwickelt und verändert. Nicht zuletzt sind ja die Forscher_innen selbst ein Einfluss, der auf das Forschungsfeld wirkt und dieses verändert. Demnach ist ein weiterer wichtiger Punkt der qualitativen Sozialforschung, den eigenen Einfluss auf das Forschungsfeld und auch auf die Forschungsergebnisse mitzuerheben und zu analysieren.
Obwohl quantitative und qualitative Ansätze hier gegenübergestellt wurden und diese Differenzierung in vielen Lehrbüchern zu finden ist, wird sie auch immer wieder kritisiert. In der Praxis gibt es zahlreiche Mischformen und Kombinationsvarianten. „Methodentriangulierung“ ist der Fachbegriff dafür, wenn unterschiedliche Verfahren zur Datengewinnung und Datenanalyse kombiniert werden, um einen guten und tiefgehenden Einblick in ein Forschungsfeld zu bekommen.
Die unterschiedlichen Ansätze werden hier nicht zuletzt deshalb in dieser Form gegenübergestellt, um zu zeigen, dass die Bedeutung und die Bewertung dessen, was „Forschung“ ist und leisten soll, auch innerhalb der sozialwissenschaftlichen Community keineswegs einheitlich verstanden werden.
Bei aller Verschiedenheit der Paradigmen und Vorgehensweisen zeichnet sich wissenschaftliche Forschung aber doch stets dadurch aus, dass (Forschungs-)Fragen in den meisten Fällen nicht zu klaren Antworten, sondern zu weiteren Fragen führen – diese Fragen sind dann aber auf „höherem Niveau“ angesiedelt: D.h. ich weiß nun mehr über meinen Forschungsgegenstand und kann präzisere und interessantere Fragen stellen als bei der ersten Forschung(-setappe).
Außerdem erfordert jede wissenschaftliche Forschung Neugierde und Offenheit, damit möglichst unvoreingenommen an neue Themen und Forschungsfelder herangegangen werden kann2. Bewertungen von Ideen oder von Wissen sind in der wissenschaftlichen Forschung hinderlich, weil sie tendenziell den Blick verstellen. Wir haben unsere Versuche den Schüler_innen möglichst unvoreingenommen gegenüberzustehen und uns „überraschen zu lassen“ im Team auch „pragmatische Naivität“ genannt (# link PAR-essay von Karin). Denn nur, wenn ich versuche, einem Forschungsfeld positiv und möglichst vorurteilslos gegenüberzustehen, bin ich offen für neue Entdeckungen, für Überraschungen und Unvorhergesehenes – und genau das sind ja besonders interessante Forschungsergebnisse.
„Zuerst denkst du, es ist ganz einfach love ist love. Und dann merkst du, es geht um kompliziertere Sachen.“3
Innerhalb des Schulsystems Forschung (nach dem interpretativen Paradigma) zu machen, bedeutet also auch, sich für andere Vorstellungen von Wissen und Wissenserwerb zu öffnen: Neugierde und scheinbar absurde und schräge Ideen und Assoziationen sind wichtige Bestandteile von Forschung. Gedankenexperimente und gewagte Verknüpfungen sind gefragt. „Dumme“ Fragen gibt es ebenso wenig wie „richtige“ oder „falsche“ Antworten. Es gibt lediglich Wege und Optionen, die interessanter oder viel versprechender erscheinen als andere und in einem späteren Stadium des Forschungsprozesses kann von plausibleren oder weniger plausiblen Antworten gesprochen werden. Ein möglichst offenes und breites Ausloten des Forschungsfeldes und der Forschungsfrage sind notwendig, um überraschende und innovative Erkenntnisse zu erlangen. Daraus folgt, dass Bewertungen (auch wenn sie in manchen Schulformen beispielsweise durch das Benotungssystem immer wieder präsent sein mögen und dort wichtig sind), im Forschungsprozess kontraproduktiv sind, denn sie schränken die Interpretationsoptionen vorzeitig ein.
Wissenschaftliches Forschen bedeutet also, sich auf Unsicherheit und (den Versuch von) Wertfreiheit einzulassen. Das Aufeinandertreffen dieser unterschiedlichen Vorstellungen war, unserer Beobachtung nach, für Schüler_innen, Lehrer_innen und Forscher_innen bereichernd, aber auch immer wieder irritierend. So meinte etwa eine Schülerin am Ende des ersten Forschungs-Schuljahres: „Ich habe gedacht, wir werden diese Fragen, die am Anfang am Plakat gestanden sind, [z.B. „Wie kann man sich verlieben?“, „Ist es wirklich Liebe, wenn man am nächsten Tag wieder Schluss macht?“], beantworten. Ich hab wirklich gedacht, wir werden die einfach beantworten.“ (audiotape_090507). Sie hatte also erwartet, dass es in der Forschung – wie oft in der Schule – klare Antworten auf die gestellten Fragen gibt. Dass am Ende vielleicht mehr Fragen stehen als Antworten, diese nun aber auf einem viel komplexeren Niveau, hatte sie nicht gedacht. Eine Mitschülerin ergänzte „Zuerst denkst du, es ist ganz einfach love ist love. Und dann merkst du, es geht um kompliziertere Sachen.“ Erstgenannte Schülerin meinte auch „Das war ur anstrengend heute. Ich hab noch nie soviel gearbeitet. Ich mein‘ da drinnen in meinem Kopf“ (alle: BP_KS_090507). Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen mit einer Art Wissen zu generieren beschäftigt waren, die sie nicht gewohnt sind: Durch die Erfahrung eine teilnehmende Beobachtung gemacht zu haben sowie die nachfolgenden Diskussionen, Reflexionen, die Bearbeitung eines Beobachtungsprotokolls und neuerliche Diskussionen, dachten die Schüler_innen viel über soziale Strukturen, über Regeln sowie das Verhalten von ihnen selbst und ihren Mitschüler_innen nach. Am Ende dieser Projekttage standen aber nicht unbedingt klare Antworten darauf, was Liebe ist, wie man sich verliebt, etc., sondern neue Fragen.
Diese Art zu forschen trifft im Regelschulsystem allerdings auf andere Strukturen4: Es gibt Lehrpläne, welche die Relevanz unterschiedlicher Themenfelder klar vorgeben. Es gibt ein klares Notensystem, das die Leistungen der Schüler_innen bewertet und dem angesichts der beruflichen Zukunft der Schüler_innen einer KMS (wer schafft welche Noten in der 4. Klasse, um an eine mittlere oder gar höhere Schule wechseln zu können, wer hat realistische Chancen auf eine (gute) Lehrstelle, wer schafft überhaupt den Hauptschulabschluss?, etc.) große Bedeutung zukommt. Dieses System baut also auf der expliziten Bewertung (und Bewertbarkeit) von Fertigkeiten und Fähigkeiten auf. Um „Wissen“ benoten zu können, werden unter anderem „richtige“ von „falschen“ Antworten unterschieden. Durch den Lehrplan (und in weiterer Folge den Arbeitsmarkt) wird definiert, welches Wissen gewusst werden soll, welches Wissen also besonders relevant ist. In der Sozialforschung sind hingegen unterschiedliche Bewertung von Themenfeldern (beispielsweise als „sinnvoller“ oder „wichtiger“ als andere) oder von Antworten auf (Forschungs-)Fragen hinderlich. Hier kommt es ganz im Gegenteil darauf an, den Blick dafür zu öffnen, dass auch in scheinbaren „Randgebieten“ (z.B. Chatten, Graffiti, Fußball, etc.) wichtige gesellschaftliche Prozesse stattfinden.
Ich möchte hier keineswegs die vielen Versuche alternative Formen der Wissensvermittlung in der Regelschule auszuüben bzw. zu implementieren unterschlagen oder gar die Schule insgesamt in ihrer (auch) disziplinierenden Form karikieren. Mir geht es hingegen darum, darauf aufmerksam zu machen, dass in der Begegnung von Wissenschaft und Regelschule unterschiedliche Systeme aufeinander treffen, die unterschiedlich verortet sind, unterschiedliche Zielsetzungen und Erwartungen erfüllen und bisweilen unterschiedlichen Logiken folgen. In diesen Begegnungen können alle Beteiligten viel lernen, wenn sie sich darüber klar sind, dass gleiche Begriffe mitunter unterschiedliche Bedeutungen haben.
Was die Schüler_innen in solchen (Sozial-)Forschungsprojekten lernen können, ist also nicht in erster Linie Faktenwissen, sondern Fähigkeiten (z.B. Diskutieren, Thesen aufstellen, (Selbst-)Reflexion) und Techniken (z.B. Recherchieren, Protokollieren, Schreiben, etc.), die sie allerdings auch in anderen schulischen und beruflichen Bereichen anwenden können, die mit Forschung gar nichts zu tun haben.
Diese sehr offene Form Wissen mit den Schüler_innen gemeinsam zu generieren führte unserer Beobachtung nach auch dazu, dass sich Rollen und Positionen von Schüler_innen veränderten: Durch die Kleingruppenarbeit, die wir durch das Forschungsteam in einer Form gewährleisten konnten, die in der Regelschule kaum möglich ist, konnten die Schüler_innen intensiver betreut werden. Wir wollten und konnten ihren inhaltlichen Wünschen in Bezug auf Inhalt und Methoden nachgehen, d.h. mit ihnen das beforschen, was sie in interessierte. All dies führte dazu, dass stille oder desinteressierte Kinder im Schulunterricht mitunter großes Engagement und Enthusiasmus zeigten, wenn es um Forschung ging und dass Fähigkeiten von Schüler_innen sichtbar wurden, von denen weder wir noch die Lehrer_innen gewusst hatten.
Literatur
Baumann, James F. (1996). Research News and Comment: Conflict or Compatibility in Classroom Inquiry? One Teacher’s Struggle to Balance Teaching and Research. Educational Researcher, 25(7), 29-36.
Diekmann, Andreas (2008): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (19. Aufl, vollst. überarb. und erw.)
Lamnek, Siegfried (2005): Qualitative Sozialforschung, Weinheim: Beltz (4.Aufl, vollst. überarb.)
Flick, Uwe / Kardoff, Ernst von / Steinke Ines, Hg. (2009): Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Noffke, Susan / Somekh, Bridget (2008): Action Research, in: Somekh, Bridget & Lewin, Cathy (Eds.), Research Methods in the Social Sciences (pp. 89-96). Los Angeles, et al: Sage Publications.
Wilson, Suzanne M. (1995). Not Tension but Intention: A Response to Wong’s Analysis of the Researcher/Teacher. Educational Researcher, 24(8), 19-22.
Wong, David E. (1995:. Challenges Confronting the Researcher/Teacher: Conflicts of Purpose and Conduct. Educational Researcher, 24(3), 22-28.
1 Ich bleibe hier bei einer Darstellung der recht konventionellen Vorstellungen von Sozialforschung. Experimentellere oder kontroverse Definitionen sind nur am Rande erwähnt.
2 Unvoreingenommenheit ist natürlich nur ein angestrebter Näherungswert: Niemand ist völlig vorurteilsfrei: Wir haben alle bestimmte Ideen und Meinungen im Kopf und tragen bestimmte Wertungen mit. In der Wissenschaft wird jedoch – mit verschiedenen Methoden – versucht, diese entweder gering zu halten (positivistisches Paradigma) oder zu reflektieren und damit sowohl offen zu legen als auch bearbeitbar zu machen (interpretatives Paradigma).
3 Zitat einer Teilnehmerin der Forschungsgruppe „Liebesorte in der Schule“ (#link Beobachtungsinterpretation).
4 Der folgende Absatz betrifft keineswegs alle Schulformen, sondern bestimmte Schulen des Regelschulsystems.