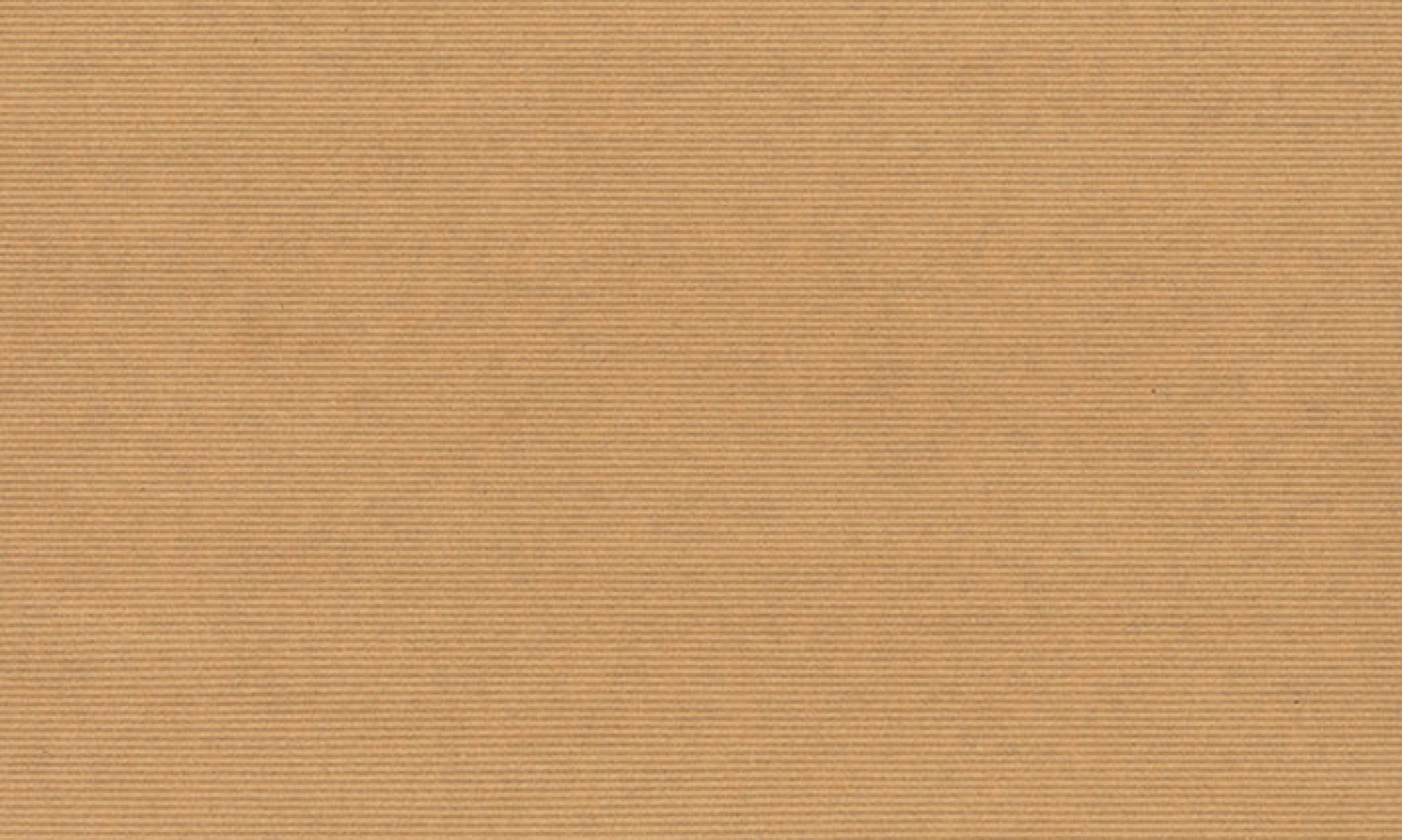Was verstehe ich unter „Partizipation“?
Wenn ich es möglichst kurz ausdrücken sollte, würde ich „partizipative Zusammenarbeit“ im Kontext des Projektes „Tricks of the Trade“ wohl als eine bestimmte Form der Aufgabenteilung zwischen Wissenschafter_innen, Schüler_innen und Lehrer_innen beschreiben, die von stetigen Aushandlungsprozessen zwischen diesen drei Gruppen geprägt war. Dabei gab es stetige Versuche aufeinander ein- und zuzugehen und ein Interesse daran, am Ende mehr zu wissen als am Anfang. Wir entwickelten eine Form der Arbeitsteilung, in der die Lehrer_innen einen Großteil der Strukturen und Rahmenbedingungen setzten (wann und wie oft finden die Treffen zwischen Wissenschafter_innen und Schüler_innen statt, was muss dabei gewährleistet sein?, z.B. rechtlichen Bedingungen, Elterninformation, etc.), die ausgebildeten Sozialforscher_innen einen Teil der inhaltlichen Inputs lieferten (z.B. Forschungsmethoden einbringen, Arbeitsmaterialen und Literatur vorbereiten, Ideen zu Dissemination vorschlagen), aber auch die Einheiten mit den Schüler_innen strukturierten (z.B. Entwicklung der Vermittlungsmethoden, Moderation der Gespräche, Überwachen des Einhaltens eines produktiven Arbeitsklimas) und die Schüler_innen die meisten konkreten Inhalte (z.B. Forschungsthemen, Forschungsfragen, ihre eigenen Erfahrungen und Hypothesen) einbrachten. Natürlich trugen auch die Forscher_innen und die Lehrer_innen (die bei den konkreten Forschungsgruppen jedoch nicht durchgehend anwesend waren) Erfahrungen und Hypothesen bei, doch die Wissenschafter_innen verstanden sich eher als die, die Vorstellungen der Schüler_innen ermutigten, unterstützten und umsetzen halfen.
Im Nachhinein finde ich, dass die Aushandlungsprozesse sowohl mit den Schüler_innen als auch mit den Lehrer_innen zu den besonders interessanten Erfahrungen dieses Projekts gehören – auch wenn ich sie in der Zeit der Durchführung nicht selten als mühsam und schwierig erlebte. Die Verhandlungsgegenstände waren mit diesen beiden Gruppen durchaus unterschiedlich: Mit den Lehrer_innen verhandelten wir vorwiegend Rahmenbedingungen und den Zugang zu den Schüler_innen, also z.B., wie oft wir kommen konnten, welche Ressourcen wir verwenden konnten, etc. Diese Verhandlungen waren vermutlich für beide Seiten immer wieder anstrengend, weil sehr unterschiedliche Systeme und Erwartungen aufeinander trafen. (Die unterschiedlichen Herangehensweisen von Schul- und Forschungskultur an Wissensproduktion, Fakten, Bewertungen, etc., werden im Artikel Forschung trifft Schule # LINK näher erläutert). Außerdem gab es mit den Lehrer_innen auch bereichernde Diskussionen darüber, was Soziologie und was Forschung bedeuten (können), wie Bildungsferne in diesem Schulsystem produziert wird, welche Rolle Migrationshintergründe und Klassenzugehörigkeiten spielen. Diese Diskussionen fanden aber (leider) oft in Abwesenheit der Schüler_innen statt.
In den Verhandlungen mit den Schüler_innen ging es vor allem darum, was wir in dieser Zeit, die wir gemeinsam verbrachten, machen wollten. Im Unterschied zu den Lehrer_innen und Wissenschafter_innen ging es für die Schüler_innen weder um bezahlte Arbeitszeit noch um Prestige, Lebensläufe oder beruflichen Ethos. Sie hatten jedoch ein Interesse daran, diese Zeit, die sie in der Schule und in diesem Fall eben mit dem „Forschungsprojekt“ verbrachten, möglichst lustvoll und angenehm zu verbringen. Den Wissenschafter_innen ging es in erster Linie darum zu forschen, d.h. Daten zu generieren und zu analysieren sowie die Schüler_innen in diesem Prozess mitzunehmen. (Außerdem lief als quasi „zweite Schiene“ für die Wissenschafter_innen nebenher, dass in der Gruppe Diskussionsfähigkeit hergestellt oder bewahrt werden musste und also darauf zu achten war, dass die Schüler_innen weder physisch noch geistig allzu weit „abdrifteten“. Das „Wollen“ der Wissenschafter_innen war also immer auch ein Pädagogisches. ) Diese unterschiedlichen Interessen trafen sich meist dort, wo die Schüler_innen etwas machen konnten, das ihnen ohnehin Spaß machte (Chatten, im Internet recherchieren, in den Park gehen, über das eigene Verliebt-sein sprechen, etc.) und wir mit ihnen an diesen Beispielen etwas erforschen konnten.
Der „Deal“ war also in etwa der: Ihr könnt mit uns etwas machen, das euch Spaß macht, aber wir diskutieren, reflektieren und analysieren gemeinsam, was ihr da tut bzw. was wir da tun. Auf diese Weise wurden die Schüler_innen selbst allerdings immer wieder – aber keineswegs immer, wie in den Darstellungen der Forschungsgruppen „Fußball“ und „Beruf und Forschung“ zu sehen ist – nicht nur zum Subjekt, sondern auch zum Objekt der Forschung, d.h. sie forschten zwar selbst, doch erforschten sie dabei auch sich selbst bzw. ihre engere Umgebung (ihre Schulkolleg_innen, Freund_innen, etc.). Dieses „Zusammenfallen“ von Forschungssubjekt und Forschungsobjekt, wird in der feministischen Methodendiskussionen immer wieder thematisiert und mitunter als notwendige Reflexion auch gefordert (vgl. Fine 1994, Wilkinson/ Kitzinger 1996), es entspricht auch einigen konkreten empirischen Methoden, wie beispielsweise der Erinnerungsarbeit von Frigga Haug (Haug 1990). Zudem ist es auch ein sehr häufiges Phänomen partizipativer Sozialforschung (PAR): Viele PAR-Projekte, nicht zuletzt der Bereich des ‚teacher research’ haben einen Aspekt der eigenen Arbeits- oder Lebenswelt der (Ko-)Forscher_innen zum Gegenstand (vgl. z.B. Whyte 1990; Maguire 1987 bzw. Wong 1995, Wilson 1995, Baumann 1996).
In unserem Projekt führte diese Vorgehensweise in besonders produktiven Momenten zu einer gemeinsamen Reflexion des eigenen Tuns und eventuell des eigenen Begehrens dahinter. Es kam in vielen Gruppen zu einer analytischen Reflexion der eigenen Standpunkte oder auch der verwendeten Methoden. Um ein Beispiel aus dem Bereich teilnehmender Beobachtung zu nehmen: Unterschiede zwischen verdeckter und offener Beobachtung sowie zwischen Beobachtungen in einer fremden versus einer vertrauten Umgebung sowie die Auswirkungen des Beobachtungsprozesses auf die Beobachteten wurden von den Schülerinnen angesprochen und aufgezeichnet.
Eine weitere Erfahrung, die für mich zentral war und die mir meine eigene wissenschaftliche Sozialisation und Vorstellungswelt bewusster machte, war die, dass partizipative Sozialforschung eine aktive Involvierung der Wissenschafter_innen in das Forschungsfeld bedeutet, die über das hinausgeht, was ich aus meinen bisherigen Feldforschungen kannte. D.h., um mit den Schüler_innen zu forschen war es immer wieder notwendig, nicht nur ins Feld zu gehen, dort zu beobachten, zu befragen, und sich dort also „zu verhalten“ – diese Form der Involvierung und des Agierens ist in jeder Feldforschung und in jeder Ethnographie Teil der sozialwissenschaftlichen Arbeit – sondern Vieles immer wieder neu und aktiv zu verhandeln, z.B. Zeiten, Räume, Strukturen oder Inhalte. Wir mussten uns, wie bereits festgehalten, gegenüber der Schule Freiräume, Orte und Zeiten, in denen wir mit den Schüler_innen forschen wollten, ebenso ausverhandeln, wie mit den Schüler_innen Zeit und Energie für Reflexionen und Analysen. Wir waren in dieser Zusammenarbeit nicht nur als Wissenschafter_innen, sondern auch als Vermittler_innen bisweilen auch als Sozialpädagog_innen gefragt: Denn wir mussten in der Arbeit mit den Schüler_innen ja auch aktiv Rahmen und Regeln setzen. 11- bis 13-jährige Schüler_innen erwarten dies (mit Recht) von Erwachsenen, die mit ihnen arbeiten.
Oft wurden wir auch nach unserer Meinung oder nach unseren Erfahrungen gefragt. Diese auch zu sagen ist zwar eine in der feministischen Sozialforschung bereits seit langem geforderte Haltung (vgl. Oakley 1990), doch in der Beziehung zwischen Sozialforscher_innen – die fast durchwegs als Lehrer_innen wahrgenommen wurden – und jungen Schüler_innen kommt solchen Aussagen eine relativ schwerwiegende Bedeutung zu. Aus der Perspektive der Schüler_innen (und der Schule) sind dies nachvollziehbare Erwartungen. Sie stellten mich persönlich aber vor große Herausforderungen. So komme ich aus einer sozialwissenschaftlichen Forschungstradition, in der eine abwartende, relativ distanzierte Haltung gegenüber dem Feld empfohlen wird. Es wird versucht wenig und vorsichtig zu intervenieren und dann sorgfältig zu beobachten, was diese Interventionen bewirken. Eine Haltung also, die verhältnismäßig viel Distanz und Zeit erfordert – zwei Dinge, die wir in den allermeisten Situationen nicht hatten. Nur allzu oft waren wir gefordert flexibel, rasch und deutlich zu intervenieren, auf Veränderungen zu reagieren, neue Regeln zu setzen, etc. Die Auswirkungen dieser Interventionen konnten nicht sorgfältig aufgezeichnet werden, sondern es musste meist unmittelbar darauf wieder etwas Neues gesetzt werden. Wir nahmen unsere unterschiedlichen Rollen also gleichzeitig ein: Während wir für die Schüler_innen (und Lehrer_innen) zumeist in erster Linie als Vermittler_innen (und teilweise als Sozialpädagog_innen, als erwachsene Ansprechpartner_innen, als Ratgeber_innen, etc.) sichtbar waren und nach didaktischen und pädagogischen Kriterien angesprochen und bewertet wurden, war zumindest ich nach meinem eigenen Verständnis zuallererst Sozialwissenschafterin, die versuchte zu beobachten, was wer warum tut und nur dann Interventionen setzte, wenn sie unbedingt notwendig schienen.
Ein Versuch mit dieser Rollenvielfalt umzugehen, war die Idee die Positionen im sozialwissenschaftlichen Team aufzuteilen und neben expliziten Vermittler_innen in der Gruppe auch Beobachter_innen-Positionen zu vergeben. Dies hätte aus personellen Gründen bedeutet, weniger Kleingruppen zu machen, aber es erschien uns dennoch sinnvoll. Ich selbst habe ein Mal eine solche Position eingenommen – genau an jenem Tag, an dem ein Streit unter Jugendlichen zu einer Eskalation führte. Um ehrlich zu sein, bis heute denke ich, dass ich meine Beobachtungsposition aktiver hätte verlassen müssen. Bis heute weiß ich nicht, ob das etwas geändert hätte. Ich weiß aber, dass ich danach keine Ambitionen mehr hatte, mich noch einmal in die Beobachterinnen-Position zu begeben. Sie schien mir in dem Setting schlicht kaum durchführbar zu sein.
Abgesehen von der Schwierigkeit all diese Rollen und Erwartungen gleichzeitig einzunehmen bzw. zu erfüllen, wurde mir bewusst, dass meine sozialwissenschaftliche Ausbildung mich für die Mehrzahl dieser Rollen auch gar nicht qualifiziert. So bin ich zwar ausgebildet Widerstände, diskreditierende Äußerungen, Konflikte, Ausschlüsse oder auch Gewalt von seiten des Forschungsfeldes zu interpretieren, nicht aber dafür, mit diesen (sozial-)pädagogisch umzugehen. Ethnomethodologische und ethno-psychoanalytische Ansätze zeigen, dass Widerstände, Irritationen und unerwartete Reaktionen auf Seiten der Erforschten wie der Forschenden besonders ergiebige Daten sind (e.g. Garfinkel 1984, Erdheim 1991). Erdheim hält fest, dass die Rolle, die Feldforscher_innen zugesprochen wird, Teil einer Verteidigungsstrategie von Personen aus dem Forschungsfeld sein kann. Forscher_innen sind Fremde und eine mögliche Irritation der dominanten sozialen Ordnung in einem Feld: Sie kennen die herrschenden Regeln nicht, verstoßen gegen diese und rufen damit Unwillen bei den „Beforschten“ hervor, die versuchen diese Irritationen zu neutralisieren (Erdheim 1988: 30).
Ich habe als Soziologin also gelernt, eine Verweigerung, einen Konflikt oder sogar dessen Eskalation zu beobachten, zu beschreiben und zu interpretieren. Ich bin aber nicht dafür ausgebildet, verhandlungstaktisch zu agieren, um im Feld etwas durchzusetzen oder im Konfliktfall de-eskalierend einzugreifen oder zu supervidieren. Im Gegenteil, zu stark zu intervenieren, entspricht gar nicht meinem wissenschaftlichen Interesse. Obwohl dies (sozial-)pädagogisch sinnvolle Vorgehensweisen im Konfliktfall sind, habe ich einerseits wenig Erfahrung und Repertoire darin, andererseits auch nur im Notfall ein Interesse daran. Ich möchte nicht behaupten, dass eine distanziert-beobachtende soziologische Haltung ein Eingreifen aktiv verhindern oder „verbieten“ würde, doch es legt ein solches nicht nahe. Es steht nicht im Zentrum sozialwissenschaftlicher Datenerhebung oder Datenanalyse, ist mithin also nicht Teil der Ausbildung oder der üblichen Forschungspraxis.
Wie kann ich aber dennoch produktiv mit solchen Situationen umgehen? Ich möchte in diesem Text weder große ethische Fragen zur (der Durchführung von) Sozialforschung erörtern noch für eine klare Trennung von Sozialforschung und Sozialpädagogik plädieren – für die es sicher gute Gründe gibt. Ich möchte hingegen für das Ernstnehmen der eigenen Involviertheit und der eigenen Grenzen plädieren, für den Mut dazu und das Sichtbarmachen dessen, dass wir Sozialforscher_innen niemals „unschuldig“ sind, sondern uns in der Feldforschung stets in der einen oder anderen Form „schmutzig“ machen: „one must be in the action, be infinite and dirty“ meint Donna Haraway, wenn sie über Forschung spricht (Haraway 1997: 36). Es kommt meiner Meinung nach darauf an, diese Unvollständigkeit, Unzulänglichkeit und Schmutzigkeit in der Forschung ernst zu nehmen und zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Gerade die Punkte, an denen unterschiedliche Erwartungen aufeinander treffen, an denen Versprechen nicht eingelöst werden, Überforderungen auftreten, etc. sind Momente, an denen sich Systematiken und Regeln zeigen. Es sind Momente, die, wenn sie sorgfältig analysiert statt verschwiegen werden, für die Forschung sehr produktiv sind, die aber – und das soll nicht vergessen werden – für andere Teilnehmer_innen und andere Systeme (in diesem Fall: die Schule, Lehrer_innen, Schüler_innen oder Eltern) gleichzeitig mitunter sehr unangenehme Auswirkungen haben.
Partizipation ist meiner Ansicht nach also immer ein Aushandeln und ein Abwägen verschiedener Wünsche, Erwartungen und Zielsetzungen. Verschiedene Akteur_innen aus verschiedenen Institutionen und Systemen treffen aufeinander. Unterschiedliche Bedeutungen gleicher Begriffe und Ereignisse müssen verhandelt werden. Im besten Fall kommt es zu einer gemeinsamen Verständigung und zu einem Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind, auch wenn es für die verschiedenen Teilnehmer_innen und Systeme wohl immer Unterschiedliches bedeutet und unterschiedliche Konsequenzen hat.
Literatur:
Baumann, James F. (1996): Research News and Comment. Conflict or Compatibility in Classroom Inquiry? One Teacher’s Struggle to Balance Teaching and Research, in: Educational Researcher, 25(7): 29-36.
Erdheim, Mario (1988): Die gesellschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Eine Einführung in den ethnopsychoanalytischen Prozeß, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2. Aufl.
Erdheim, Mario (1991): Psychoanalyse und Unbewusstheit in der Kultur, Frankfurt/Main: Suhrkamp
Fine, Michelle (1994): Working the hyphens. Reinventing the Self and Other in qualitative research, in: Denzin, Norman K. / Lincoln, Yvonna S., eds.: Handbook of qualitative research, Newbury Park, CA: Sage: 70-82
Garfinkel, Harold (1984 [1967]): Studies in Ethnomethodology, Malden: Polity Press/Blackwell Publishing
Haraway, Donna (1997): Modest_Wittness@Second_Millenium. Femaleman©_Meets_Oncotmouse™, Feminism and Technoscience, New York: Routledge
Haug, Frigga (1990): Erinnerungsarbeit, Hamburg: Argument-Verlag
Maguire, Patricia (1987): Doing Participatory Research: A Feminist Approach, Amherst (Massachusetts): Center for International Education, University of Massachusetts/Amherst
Oakley, Ann (1990): Interviewing Women. A Contradiction in Terms, in: Roberts, Helen (ed.): Doing Feminist Research, London / New York 1990: 30-61
Whyte, William Foote, Hg. (1999): Participatory action research. Newbury Park, California: Sage
Wilkinson, Sue / Kitzinger, Celia, eds. (1996): Representing the Other. A Feminism and Psychology Reader, London: Sage Publications
Wilson, Suzanne M. (1995): Not Tension but Intention. A Response to Wong’s Analysis of the Researcher/Teacher, in: Educational Researcher, 24 (8): 19-22
Wong, David E. (1995): Challenges Confronting the Researcher/Teacher: Conflicts of Purpose and Conduct, in: Educational Researcher, 24 (3): 22-28.