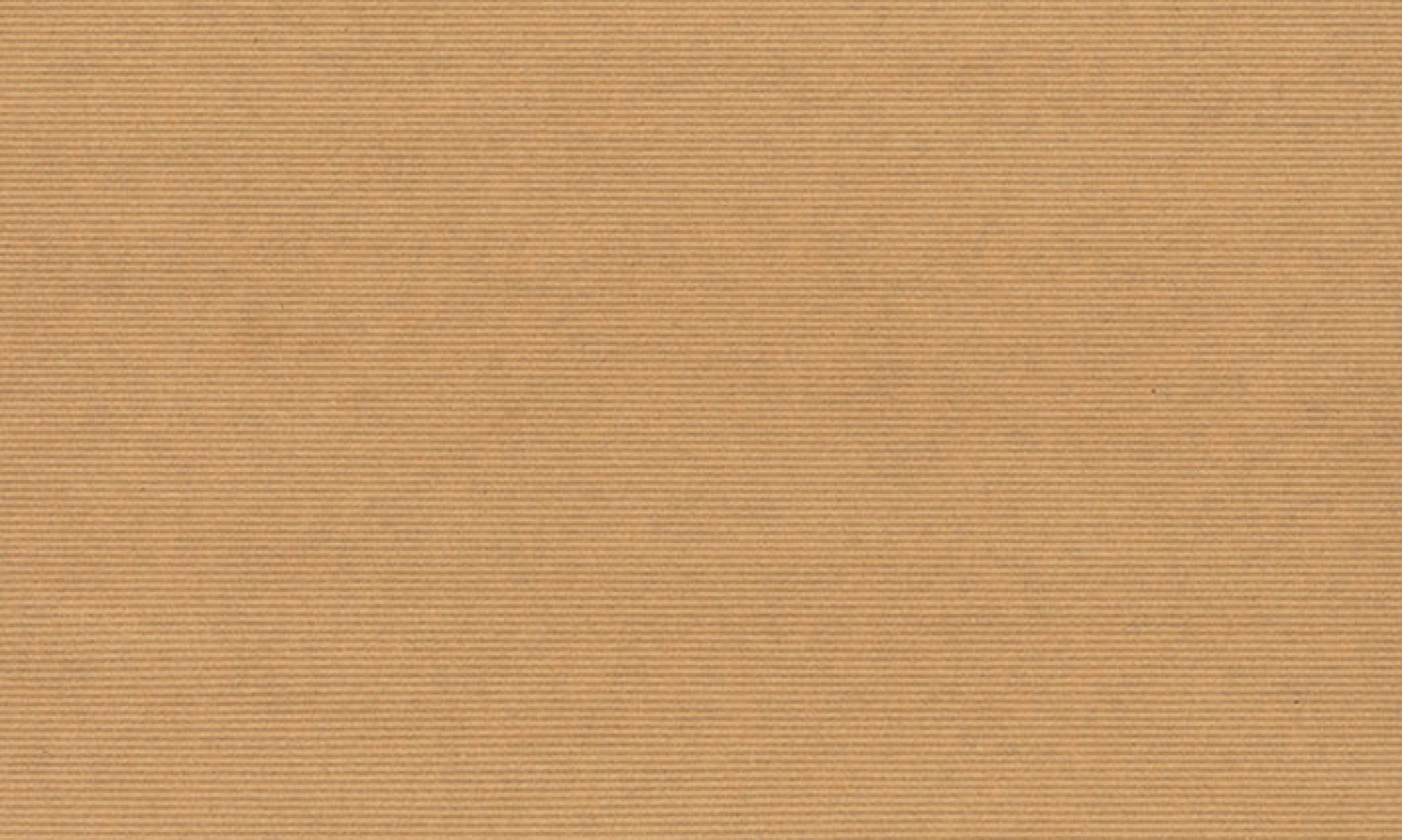von Doris Harrasser.
Ein Grundgedanke partizipativer Forschung ist die gemeinsame Entwicklung von Forschungsfragen und Strategien um diese beantworten zu können. So war es auch in unserem Projekt „Tricks of the Trade“ zu Beginn alles andere als klar, was und wie wir gemeinsam mit den Schüler_innen und der Lehrerin unserer Partnerschule forschen würden.
Wie ist es aber überhaupt möglich etwas gemeinsames zu entwickeln, in einer Situation, in der wir Forscher_innen als schulfremde Personen auf Schüler_innen und Lehrpersonen treffen, die wir nicht kennen und deren Schulalltag uns zwar da und dort an unserer eigene Pflichtschulzeit erinnert, aber dennoch eine fremde Kultur darstellt?
In der Eingangsphase unseres Projekts hatten wir (vom Forschungsteam) den Wunsch die Schüler_innen und die Klassenkultur erst einmal kennen zu lernen, um eine Vertrauensbasis und ein wechselseitiges Verstehen aufzubauen. Unsere Vorstellung dieses Ziel in Form von Hospitationen im Schulalltag zu erreichen, war aber in der Praxis letztendlich nicht durchführbar. Eine beobachtende Teilnahme am Unterricht war nicht möglich, da diese von der Klassenlehrerin als zu störend und irritierend eingeschätzt und abgelehnt wurde. Es war also von unserer Seite eine Anpassung an das Forschungsfeld notwendig, denn immerhin waren wir es ja als Außenstehende, die sich in das „System“ Schule involvierten und somit unser Vorhaben in den schulischen Alltag zu integrieren versuchten. Der Beginn unseres Projektes war also stark davon gekennzeichnet die strukturellen Möglichkeiten einer Schul- Forschungskooperation auszuloten. In welchen Zeiträumen und in welcher Form war es überhaupt möglich, mit den Schüler_innen und der Lehrerin zusammen zu arbeiten? Wir lernten in dieser Zeit einiges über die Ordnungsstrukturen in unserer Partnerschule. Zum Beispiel, dass uns als „schulfremden“ Personen der Aufenthalt in der Schule nur unter Aufsicht einer zuständigen Lehrperson gestattet war oder dass die Arbeit mit den Schüler_innen im Schulgebäude nur im Rahmen des regulären Unterrichts möglich war. Aufsichtspflicht und versicherungstechnische Regelungen stellten wesentliche Elemente in der Organisation unserer Schul- Forschungskooperation dar, ebenso wie pädagogische Überlegungen zur Verträglichkeit unserer Anwesenheit für einzelne Schüler_innen, aber auch für die Klassenkultur. Aus unserer anfänglichen Vision eines Freifachs „(Sozial)Wissenschaftliches Arbeiten“ entwickelte sich im ersten Semester eine Art Projektunterricht zu dem wir uns ca. alle zwei Wochen für zwei Unterrichtseinheiten in der Schule einfanden.
Wie die meisten Organisationsformen brachte diese Projektstruktur einige Vor- und Nachteile mit sich. Positiv war, dass wir so alle Schüler_innen einer Klasse mit unserer Idee, gemeinsam Sozialforschung zu betreiben, erreichen konnten und so möglichst viele Schüler_innen die Möglichkeit erhielten, daran teilzunehmen. Weiters brauchten wir uns nicht um die zeitlichen und örtlichen Projektstrukturen zu kümmern, da diese durch die Unterrichtszeit und den Unterrichtsort vorstrukturiert waren. Andererseits ging dadurch unser ursprünglicher Anspruch einer freiwilligen Mitarbeit verloren.
Im 2-Wochenrhythmus in jeweils zwei Unterrichtseinheiten ein partizipatives Forschungsprojekt zu gestalten, stellte allerdings für alle Beteiligten eine Herausforderung dar. Zunächst war es für die Schüler_innen alles andere als klar, was mit Sozialwissenschaft gemeint sein sollte und wie wir gemeinsam Sozialwissenschaft betreiben könnten, war ja auch für uns als Forschungsteam alles andere als vorhersehbar. So gestaltete sich das erste Semester als eine Mischung aus wechselseitigem Kennen lernen von Schüler_innen und Forscher_innen, unserem Versuch ihnen wichtige Elemente zum Verständnis von Sozialforschung zu vermitteln (welche Fragen stellen Sozialforscher_innen, wie kann die soziale Welt erforscht werden – mit welchen Methoden?) und einzelnen Versuchen Miniaturforschungen in der Schule auszuprobieren: Zum Beispiel durch Beobachtungsrundgänge in der Schule. Schwierig in dieser Forschungsphase war: Die Arbeit im ganzen Klassenverband oder viel zu großen Teilgruppen, eine sehr große Fluktuation bzgl. der anwesenden Schüler_innen aber auch die Unklarheit, wohin denn unser Projekt letztendlich führen sollte. Da wir ja nicht vorgeben wollten, was denn nun gemeinsam erforscht werden sollte, entstanden immer wieder Momente der Orientierungslosigkeit.
Die Basis jeder Forschungsarbeit ist ein zentrales Thema, bzw. eine Forschungsfrage die im Zentrum der Auseinandersetzung steht. Nach der ersten Phase des Kennenlernens galt es also, Themen und Fragestellungen für unsere gemeinsame Forschung zu bestimmen. Dies klingt so leicht, in der Praxis ist es aber alles andere als leicht, sich für ein Interessensgebiet zu entscheiden. Wir stellten eine Forschungsfragebox im Klassenzimmer auf, in die Fragen geworfen wurden; wir führten Interviews mit jedem der Schüler_innen um ihre Interessensgebiete und Themenwünsche zu erfassen. Die daraus entstandenen Themen und Fragen gruppierten wir in der Folge zu mehreren Themenblöcken, aus denen die Schüler_innen in der Folge ein Thema für sich auswählen sollten.
All dies klingt recht einfach, in der Praxis war dieser Aushandlungs- und Entscheidungsprozess allerdings ein sehr langwieriger und anstrengender Prozess. Der Versuch diesen Prozess möglichst partizipativ zu gestalten und möglichst nicht über die Köpfe der Schüler_innen hinweg Entscheidungen zu treffen, war nicht immer ein emanzipatorischer Akt, sondern auch immer wieder überfordernd, anstrengend und nervenaufreibend für alle Beteiligten.
Die Gruppenfindung zu verschiedenen Forschungsthemen am Ende des ersten Semesters war für mich persönlich ein Meilenstein und eine große Erleichterung. Denn nun konnten wir uns (was meine Forschungsgruppe betraf) auf das Thema „Chatten“ konzentrieren.
„Warum chatten Jugendliche?“ war die zentrale Frage mit der sich unsere Forschungsgruppe (3 Schülerinnen und ich) beschäftigten. Von Beginn an war für mich klar, dass die Mädchen eine weitaus größere Expertise in Bezug auf das Thema Chatten mitbrachten als ich. Ich selbst verwende das Kommunikationsmedium Chat nur sporadisch – aus dem Alltag der Mädchen ist es hingegen nicht wegzudenken und ein zentrales Medium, um mit anderen zu kommunizieren. Während die Mädchen also die Expert_innen in Bezug auf das Thema „Chatten“ waren, konnte ich mein Wissen um sozialwissenschaftliches Arbeiten (z.B. Methoden zur Datenerhebung und Analyse) in die gemeinsame Forschung einbringen. Dieses gemeinsame und auch von einander Lernen, stellte sich im Laufe des Projekts als ein wesentliches Element der partizipativen Forschung mit Jugendlichen heraus.
Die Auswahl der Forschungsmethode erfolgte durch die Schülerinnen. Sie entschieden sich dafür, Chatprotokolle zu speichern und auszudrucken um diese in der Folge zu analysieren. So entwickelte sich eine Forschungssituation, die sehr eng mit den Alltagspraktiken der Mädchen, in Bezug auf das Chatten, in Verbindung standen. Dies hatte Vor- und Nachteile. Einerseits erhielten die Mädchen dadurch die Möglichkeit auch im Rahmen des Projekts zu chatten, was ihnen großen Spaß bereitete; andererseits war es dadurch auch nicht immer leicht einen distanzierteren, wissenschaftlichen Blick auf das Thema Chatten einzunehmen. Dafür Raum und Zeit zu schaffen stellte sich im Laufe des Projekts als meine Aufgabe heraus. Aus den erstellten Chatprotokollen wählten wir zunächst eines aus. In der Folge wurde es übersetzt (denn die Mädchen kommunizierten im Chat durchwegs in ihrer Muttersprache – die nicht Deutsch war). Nach dieser Aufbereitung der Daten versuchten wir diese interpretativ zu erschließen. In der Praxis bedeutete dies, einzelne Protokollstellen gemeinsam zu lesen, ihre Bedeutungen zu erfassen, sie zu diskutieren, interessante Themen zu bestimmen, Fragen zu formulieren und/oder erste Thesen zu generieren. Dieser analytische Umgang mit Kommunikationen aus dem Chat stellte für die Schülerinnen einen ganz neuen Zugang zu ihrer sonst üblichen Praxis des Chattens dar. Eine neue Möglichkeit über die eigene Alltagspraxis nachzudenken, diese mit der Praxis anderer zu vergleichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. In dieser Situation waren die SchülerInnen sowohl Subjekte, also auch Objekte der Forschung, je nachdem ob der Blick auf die eigene Chatpraxis, oder die der anderen gerichtet wurde. Auch ich wurde gelegentlich zum Forschungsobjekt – wenn meine eigene Chatpraxis zum Thema wurde.
Im Laufe des Chatprojekts das sich, über das Sommersemester erstreckte, wurden auch einzelne Treffen aus dem Schulkontext ausgelagert und in die Freizeit der Schülerinnen verlagert; auch deshalb weil es die Möglichkeit gab eine Radiosendung zum Forschungsthema zu gestalten und dafür mehr Zeit notwendig war, als im Rahmen des Schulunterrichts zur Verfügung stand. Die Bereitschaft der Schülerinnen das Projekt in ihrer Freizeit fortzuführen deutet darauf hin, dass sie es positiv für sich nutzen konnten.
Was eine solche Form der Wissenschaftskommunikation mit Kindern und Jugendlichen leisten kann ist, ihnen einen Einblick in den Prozess sozialwissenschaftlicher Wissensproduktion zu ermöglichen, indem sie selbst in diesen involviert sind. Von der Auswahl eines Themas oder einen Fragestellung, der Datenerhebung und Analyse bis zur Präsentation von Ergebnissen. Sie lernen, dass solch ein Prozess von unzähligen Entscheidungen, aber auch von den Rahmenbedingungen der Forschung abhängt und dass die Forscher_innen selbst einen wesentlichen Betrag zur Konstruktion von Forschungsergebnissen leisten. Ich als Forscherin wiederum erhielt durch unser Projekt einen sehr intimen Einblick in die Lebens- und Kommunikationswelt von Jugendlichen, den ich wohl ohne unser gemeinsames Forschen am Thema Chatten nicht erlangt hätte. Die in diesem Rahmen von mir erhobenen Daten, die ich in Form von Gedächtnisprotokollen und Audioaufnahmen sammelte, erfordern allerdings einen sehr sensiblen Umgang von meiner Seite. Nämlich dann, wenn die Schülerinnen zu „Objekten“ meiner oder unserer Forschung werden. Zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken und danach fragen, wie denn nun unser partizipatives Projekt gelaufen ist.
In Bezug auf Methodendiskussionen in der Soziologie stellt ein solches Projekt auch die Möglichkeit dar, die Wege und Mittel der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisproduktion zu hinterfragen. Gerade im gemeinsamen Forschen mit Jugendlichen können Forschungspraktiken auch reflektiert, hinterfragt oder transformiert werden. Zum Beispiel wurde in unserem „Chatprojekt“ die Dominanz des Mediums Schrift augenscheinlich, um sowohl Aussagen der beforschten Personen (der Gesprächsparter_innen) im Chat, als auch unserer Forschungsergebnisse zu fixieren. Durch die Produktion der Radiosendung kam jedoch zu mindestens ein weiteres Verbreitungsmedium zum Einsatz.