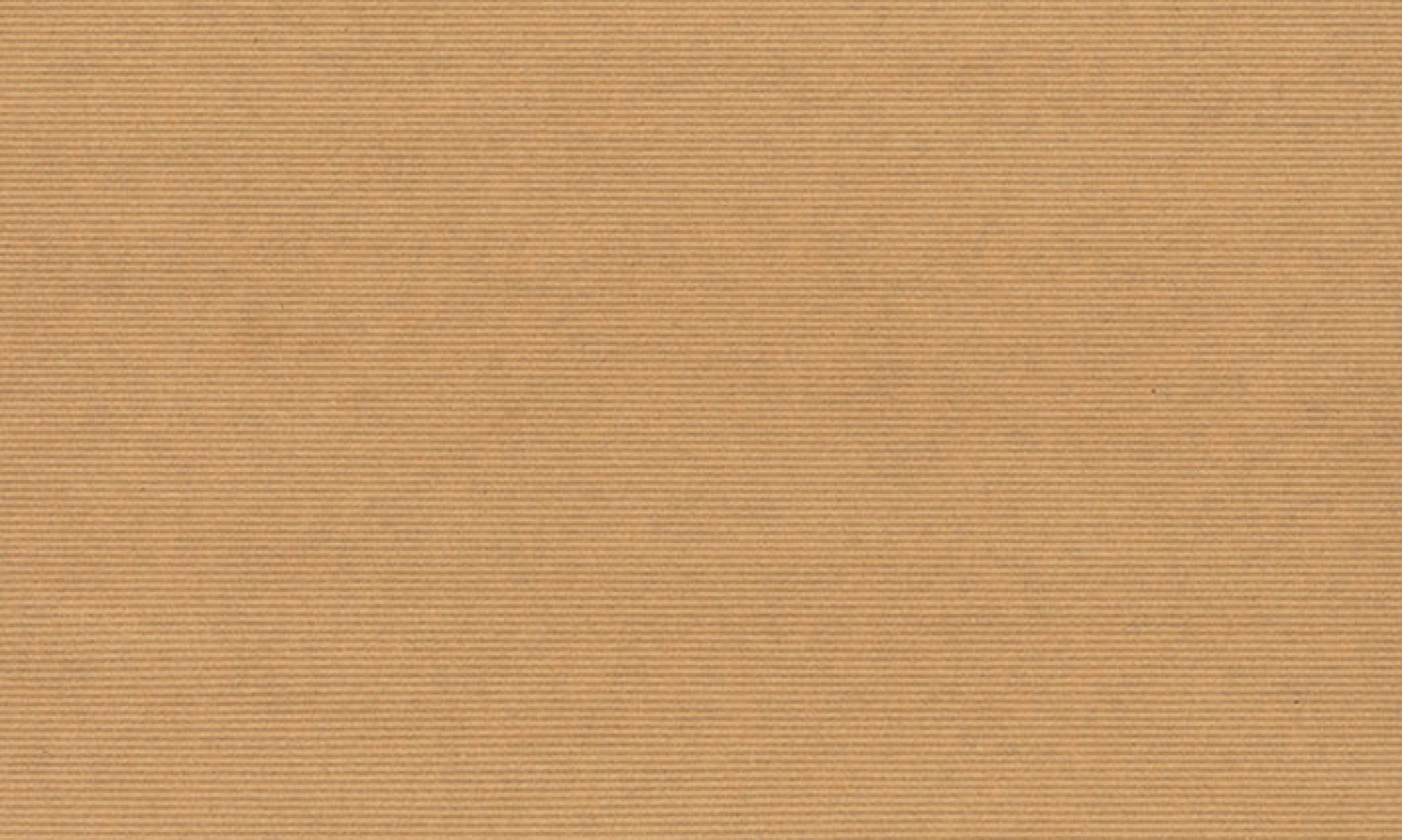In der Nachschau gliedert sich für mich das Projekt in vier Phasen der Arbeit mit den Kindern, die ich auch jeweils ganz anders erlebt habe: Zunächst mal in der Schule vor der ganzen Klasse, dann in den Kleingruppen, dann in der Projektwoche und zum Schluss das Hineinwachsen in die informelle Zusammenarbeit mit einigen wenigen Kindern rund um die Gestaltung der Homepage.
Die erste Phase war davon geprägt, dass wir alle 14 Tage in unterschiedlichsten Teamzusammensetzungen in die Schule kamen. Die zweite von einem Arbeiten in drei Kleingruppen zu unterschiedlichen Themen, welche sich aus einer Befragung der Kinder herauskristallisierten. Die von mir betreute Gruppe bestand aus drei Mädchen, die mit mir (und meist klar unter meiner Moderation) zum Thema „Liebesorte in der Schule“ forschten. Sie dient mir vor allem als Beispiel dafür, wie ich im Projekt einige Fragen als partizipativ beschreiben würde, da sich in dieser Forschungsphase einige Dinge für mich am deutlichsten zeigten und diese anhand des Datenmaterials gut nachvollziehbar sind – dies liegt auch daran, dass ich selbst mit dieser Gruppe am intensivsten gearbeitet habe. Daher werde ich auf Phase 1 und Phase 3 in diesem Text nur kontextualisierend eingehen.
Beim ersten Treffen mit den Schüler_innen kam noch das ganze Team der Forscher_innen gemeinsam in die Klasse. Ich kann mich erinnern, dass wir viel darüber nachgedacht haben, wie wir den Kindern Forschung nahe bringen können. Im Nachhinein hat sich das dann für mich immer mehr zur Frage hin verschoben, was wir mit den Kindern eigentlich beforschen wollen. Ich kann das nicht für alle setzen, würde für mich jedoch recht klar als Ergebnis sehen, dass eine Einführung in allgemeine Forschungsmethoden abstrakt ist und bleibt; ohne konkrete Forschungsfrage, so meine Lernerfahrung, kann auch nicht vermittelt werden, wozu die einzelnen Methoden angewandt werden sollen. Das Entwickeln einer Forschungsfrage war in unserem Projekt mindestens genauso schwierig, wie das oft im Forschungsalltag der Fall ist.
Zur Entstehung der Forschungsgruppe „Liebesorte in der Schule“:
Das erste Mal kam das Wort „Liebesorte“ auf, als Mavi und Susanne mich gleich am ersten Tag auf unsere Bitte hin durch die Schule führten. Ich hatte nie vor aus diesem vielleicht auch etwas surreal klingenden Begriff eine Forschungsgruppe zu machen; es war vielmehr eine spontane Bezeichnung zu verschiedenen Geschichten, die mir vor allem Susanne darüber erzählte, wer sich wo begegnen könnte. Im Nachhinein finde ich es etwas erstaunlich, dass ich selber nicht von „Freundschaftsorten“ sprach – bei einer Nachbesprechung mit der Lehrerin kam von dieser der Hinweis, dass es in der Schule wohl wesentlich mehr „Aggressionsorte“ als „Liebesorte“ geben würde und dass sich prinzipiell wenig Orte in der Schule finden, an welchen sich Kinder allein begegnen könnten. Genau in diese Richtung entwickelte sich das kleine Forschungsprojekt der Gruppe „Liebesorte“: Von der Liebe weg zu den Konflikten unter Mädchen und unter verschiedenen Kindergruppen bzw. zu der Frage nach dem Beobachten und Beobachtet-werden in der Schule (s.u.) (siehe den Beitrag in der Methodenbox „Beobachtung in der Schule“# link setzen)
Nach wie vor interessant finde ich die Fragestellung, die sich in meinem Kopf da plötzlich zusammenbraute – danach, ob und wo es in der Schule Orte und Nischen gibt, in welchen etwas passiert, das viel mit den Kindern untereinander zutun hat und weniger mit dem Unterricht und das trotzdem auch „Schule“ ausmacht.
Ein Thema wird gefunden: laute & leise Kontinuitäten
Für mich ist rückblickend auch die Kontinuität erstaunlich: Ich bin mit Mavi und Susanne durch die Schule gegangen, habe über diese „heimlichen“ Orte gesprochen und mit denselben beiden Mädchen dann eine Forschungsgruppe genau zu diesem Thema gemacht (das dritte Mädchen war Asly, die nicht beim ersten Spaziergang dabei war; die Konflikte unter den Mädchen (s.u.), die auch in der Forschungsgruppe Thema waren, betrafen aber vor allem Mavi und Susanne). Erstaunlich ist das aber nur auf den ersten Blick. Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann erinnere ich mich wieder, dass Susanne ja gesagt hat, dass sie das Thema interessiert und dass sie was dazu machen möchte und dass sie auch daran beteiligt war, dass es überhaupt zu dem Thema kam.
Mavi hat dies mit Susanne gemeinsam gesetzt, zumindest dem äußeren Anschein nach. Dass Asly hier eigentlich nicht „ihr“ Thema fand – sie hätte gerne zu Migration gearbeitet, für diese Gruppe fanden sich dann aber keine weiteren Teilnehmenden – hatte sie auch von Anfang an gesagt. In der nachfolgenden Projektphase machte sie ihr Interesse wieder stark und letztendlich ist ihr Beitrag auf der Homepage zu dem Thema Mädchen-Migration zustande gekommen; auch hier gab es also eine Kontinuität, die wir im Trubel nicht unbedingt wahrnehmen konnten.
Während mir also das erste und das zweite Semester mit ihren unterschiedlichen Strukturen als sehr zerklüftet vorkamen, fast ohne Bezug zu einander, war dies wohl aus dem Blick einiger Kinder nicht unbedingt der Fall. Zumindest schafften es diese Mädchen „ihr“ Thema zu finden, (sogleich oder ‚in the long run‘) gut zu platzieren und in eine neue Projektphase zu transformieren. Jetzt könnte mensch einwenden, dass dies nicht besonders erstaunlich ist, da doch „Liebe“ das Thema früh-pubertärer Mädchen sei. Ich würde auf diesen Einwand antworten, dass dies gewiss richtig ist, jedoch nichts daran ändert, dass hier ein partizipativer Prozess in Gang gesetzt wurde, dieses Thema ein ganzes Semester lang zum Thema einer Forschungsgruppe zu machen, obwohl es nicht im Projektantrag vorgesehen war. Genau weil es das Thema der Mädchen ist, ist es für mich ein gutes Beispiel dafür, wie es in einem gelungenen partiziativen Prozess möglich sein kann, dass sich Jugendliche in ein Forschungsdesign hineinreklamieren bzw. das Forschungssetting für die Abhandlung und Schärfung ihrer Fragestellungen benutzen. Es waren in diesem Fall also nicht primär die Forscher_innen, die eine bestimmte Fragestellung an die Kinder herantrugen. Gleichzeitig waren die Forscherinnen sehr wohl daran beteiligt, dass aus diffusen Ideen der Kinder Forschungsfragen wurden oder dass sie überhaupt ihre Ideen, Interessen oder Desinteressen formulierten: Kurzgesagt, wir stellten unser Wissen dafür zur Verfügung, Ideen zu bündeln, sie zu (mehr oder weniger) bearbeitbaren Fragen zu verdichten, Ideen zu dokumentieren, ernst zu nehmen, aufzugreifen und weiter zu verfolgen. An diesem Punkt würde ich partizipatives Arbeiten feststellen: Als Prozess, den Forscher_innen und Jugendliche betreiben, und in welchem Forscher_innen ihr Wissen zur Verfügung stellen, damit in den Raum hinein gesagte Ideen Gestalt bekommen können. Dies ist jedoch – wohlgemerkt – ein Verständnis, dass aus dem eigenen Prozess entstand und nicht eines mit dem wir in den Prozess hineingingen.
Thema: Verschiebungen und Verdichtungen
Immer dann, wenn Susanne nicht da war, erzählte nicht nur Asly, sondern auch Mavi, dass das Thema „Liebe“ eigentlich gar nicht ihr Thema sei, sondern von Susanne alleine eingebracht wurde. Unter anderem daran wurde ein Konflikt mit Susanne festgemacht und da sie lange Zeit nicht da war, entwickelte sich daraus selbst eine zentrale Forschungsfrage. Das Thema verschob sich also von den „Liebesorten“ hin zu Beziehungen und Konflikten von Mädchen untereinander (auch zwischen jenen in der Gruppe), aber auch zu anderen Beziehungs- und Konfliktlinien, z.B.: Wer kommt wo her?, Wer lacht wen aus?, Wie werden Mädchen mit Kopftuch, wie Romamädchen wahrgenommen? und Wie sehen sie sich selbst? Susanne selbst blieb – als sie gegen Ende des Semesters wieder anwesend war – bei ihrer Frage und interviewte einen Jungen aus der Forschungsgruppe „(K)ein Platz für Jungs“ und stellte erstaunt fest bzw. analysierte, dass Buben keinen Ort haben, ihre Gefühle zu äußern, weil ihr Ort die ganze Welt sei. Mädchen würden ihrerseits immer über ihre Gefühle sprechen und dadurch von diesen auch nicht loskommen. Hier hat sich, salopp gesagt, das Thema verdichtet – aus unklaren „Liebesorten“ wurden präzise Fragestellungen, und Wahrnehmungen zu Genderdifferenzen in Bezug auf das Thema. Diese würden freilich in einem weiteren Schritt genauer beobachtet und wieder hinterfragt werden (# zyklisches Forschen). Da wir für einen solchen Schritt in einem „probehaften“ und durch Schulstruktur (# link) gekennzeichneten Forschungsdurchgang keine Zeit hatten (oder auch gar nicht damit rechneten mit Einzelnen soweit zu kommen?) blieben die Ergebnisse fragmentarisch. Dennoch (und das war ja unser Hauptinteresse in diesem Fall) fanden Verläufe statt, die für qualitative Sozialforschungsprozesse kennzeichnend sind:
Ein wichtiger Bestandteil jedes zyklischen Forschungsprozess ist, dass sich die konkrete Forschungsfrage fokussiert. Dies geschieht meist in einem Prozess, in dem das zunächst oft sehr allgemeine Thema Gestalt annimmt, größer und kleiner, dicker und dünner wird und sich durch neue, in der Empirie gewonnene Sichtweisen verändert und verschiebt. Die Fragestellung zentriert sich, schält sich heraus, das Thema wird dichter, erste Thesen werden auf Grundlage von empirischen Erfahrungen gebildet und wieder verworfen.
Beides, das Finden des Themas und die Verschiebung des Themas, waren für mich ein partizipativer Prozess und es ist an diesem Beispiel gut zu sehen, dass dabei „die Kinder“ keine Einheit bilden, sondern auch verschiedene Rollen, Positionen, Forschungsinteressen untereinander formulieren. So wird (slowly, slowly) aus einer Setzung „Forschung mit Jugendlichen“ eine Forschungsgruppe, in der unterschiedliche Interessen platz haben und auf Basis gemeinsamer Erhebungen potenziell bearbeitbar werden.
Vorgeschichte
Das erste Semester in der Klasse war für mich sehr stark von einem immer-wieder-versuchen geprägt und von einem relativen noch-nicht-wissen wohin es gehen soll. Zumindest sehe ich es im Nachhinein so, da wir die Erfahrung von Arbeitsgruppen hatten, die zu ganz klaren Themen arbeiteten. Da wir in unserem Antrag schrieben, dass die Kinder zunächst einmal die Schule beforschen (um dann zu einem, im Projektantrag formulierten „Biomodell“-Labor zu gehen) und Methoden der qualitativen Sozialforschung lernen sollten, waren das die Schwerpunkte unserer Interventionen im ersten Semester. Im Nachhinein denke ich mir, dass mir/uns gar nicht aufgefallen ist, dass das riesengroße Themen sind – außerdem sind sie zu nah an und zugleich zu weit weg von ihrem alltäglichen Leben. Aber vielleicht wäre es egal gewesen, was wir am Anfang gemacht hätten, es wäre immer die Phase des sich erst einmal Orientierens für uns an dem für uns so fremden Ort gewesen, und für die Kinder und die Lehrerin, des Orientierens an dem Forschungsprojekt. Für mich war, wieder im Nachhinein, die erste Phase weniger von „Partizipation“ – also dem mit den Kindern etwas zu entwickeln – geprägt, als von einer Art „Unterricht“ ohne Unterrichtserfahrung unsererseits und das machte auch oft Unruhe und Chaos an Stellen, die wir gar nicht wollten. Das war zumindest das Feedback der Lehrerin und auch ich habe, wenn ich an das erste Semester denke, ein Wort im Kopf: „Laut“.
Dennoch gab es auch in dieser Phase Momente, die ich als partizipativ bezeichnen würde. Die Frage, die sich im Nachhinein für mich dabei stellt ist, ob uns in Ansätzen gelungen ist, in ein gemeinsames Forschen zu kommen (# verlinken), obwohl wir das in der ersten Phase noch nicht direkt mit ihnen vorhatten. In meinem Fall lag das daran, dass ich noch keine geschärfte Idee davon hatte, dass ein Miteinander-tun immer dann am Besten gelingt, wenn es eine ganz konkrete und nicht zu große Fragestellung/Aufgabe gibt, die allen „unter den Nägeln brennt“ oder zumindest, die alle interessiert oder angeht. Im Schulkontext zeigt sich auch die Schwierigkeit, dass Schüler_innen oft nicht gewohnt sind, das, was sie angeht, hier auch einzubringen. Vielmehr werden sie angehalten sich (mehr oder weniger) dafür zu interessieren, was in der Schule vorgebracht wird (#veronika text). Weiters stellt sich die Frage was „alle“ in diesem Zusammenhang bedeutet? Zumindest legen die weiteren Projektphasen nahe, dass die gesamte Klasse ein zu großer Kontext für ein partizipatives Forschungsvorhaben ist.
Dennoch gab es auch im ersten Semester immer wieder Situationen, die ich als Ansätze gemeinsames Forschen verstehen würde. Diese wurden dann aber nicht weiter verfolgt, da wir zu dieser Zeit noch mit der ganzen Klasse und zu immer unterschiedlicheren Themen arbeiteten, aber vor allem, da zumindest ich zu diesem Zeitpunkt diese kleinen Sequenzen gar nicht danach beurteilte, ob es gute Forschungsansätze wären. Diese Haltung lernte ich dann erst „by doing“ in den folgenden Kleingruppen.
Eine solche Sequenz gemeinsamen Forschens bereits im ersten Semester, wäre für mich beispielsweise die eines durchgeführten Rollenspiels:
Wir teilten die Klasse in zwei Gruppen. Während die eine Gruppe eine Klassensituation spielte, wurde sie von der anderen dabei beobachtet. Gespielt wurde eine Klassensituation unmittelbar bei Stundenbeginn. Die Lehrerin wurde von Peter gespielt, die tatsächliche Lehrerin spielte einen schlimmen Schüler; Asly, ein braves Mädchen, spielte sich selbst, zwei Mädchen spielten „Klassenkasperl“.
Bei dieser Sesselkreis-Runde sind die Kinder m.M. viel mehr bei der Sache als sonst, vermutlich weil es darum geht, das eigene Spiel zu reflektieren. Peter z.B. sagt, dass er erfahren hat, wie schwer es sei, die Lehrerin zu sein. Einige sagen, dass so ein Lehrer da vorne einsam ist, weil alle anderen noch jemanden hätten. Die beiden „Kasperln“ sagen, dass es schwer ist so zu sein, wenn die LehrerIn kein starkes Gegengewicht hätte, dass die Schlimmen sozusagen die Lehrer bräuchten um befriedigend schlimm sein zu können. Asly – das im realen Leben und im Spiel brave Mädchen – sagt, ihr war eigentlich fad, weil es so war wie immer. Die Lehrerin sagt auch etwas in die Richtung, dass es anstrengend sei und auch frustrierend, weil sie mit ihrem Wunsch aufs Klo zu gehen nicht gehört wurde (sie spielte einen schlimmen Buben, der sich ununterbrochen meldete, um aufs Klo zu dürfen), dass sie dies aber auch absichtlich gemacht hätte, um von vergessenen Sachen abzulenken.
Die Sequenz ist für mich deshalb spannend, weil hier alle, inklusive der Lehrerin, anfangen, das was sie kennen, in dem Fall die Schule, mit anderen, „forschenden“ Augen zu sehen. Gemeint ist damit der in der Sozialforschung oft beschriebene „Befremdungseffekt“ gegenüber der vertrauten Kultur, das auf Distanz-bringen von Vertrautem und das Entwickeln neuer Fragestellungen. Dennoch, wie gesagt, solche und ähnliche Forschungsmomente wurden im Team nicht aufgegriffen und weiter entwickelt, vermutlich weil sie uns in ihren Andockmöglichkeiten erst beim späteren Durcharbeiten der Protokolle bewusst wurden. Das Rollenspiel selbst will von uns als Methode gesehen werden, auf Dinge draufzukommen und genau diese anderen Sichtweisen zu entwickeln. Aber auch hier wurde von uns der Beginn nicht weiter ausgebaut, da wir in dieser ersten Projektphase möglichst viele Methoden durchprobieren wollten.
Dinge werden anders
Da Partizipation für mich auch heißt, für Vorschläge der Forschungspartner_innen offen zu sein und diese zu schärfen, war für mich der ganze, oben beschriebene Prozess im folgenden Semester das Forschungssetting umzustellen, ein partizipativer. Die Kinder und die Lehrerin sagten uns immer wieder, dass das so zu langweilig sei, etc. und auch die meisten unseres Forschungsteams teilten diese Sicht bzw. fanden, dass die Dinge nicht wirklich in eine klare Richtung gingen. Dies führte uns dazu die Kinder zu interviewen um draufzukommen, in welche Richtung sie gehen wollten. Dabei übersetzten wir das in den Interviews Gesagte teilweise in unsere Sprache oder in die Sprache eines möglichen Gruppenthemas. So hat sich bei mir der Gedanke geschärft, dass Partizipation nie nur bedeuten kann, zu schauen was jene wollen, die Nicht-Forscherinnen sind, sondern dass auch die Forscherinnen sich überlegen, was sie interessant finden, was für sie zeitlich und energetisch machbar ist, etc. Vermutlich ist es nur dann möglich, dass die Kinder wirklich erleben, wie aus dem „eigenen“, aus irgend einer Idee, einer Leidenschaft (Fußball#) oder etwas, das man gemacht hat (wie das Rollenspiel) etwas wird, das vorher so noch nicht betrachtet wurde; wie also Dinge auch von anderen Seiten betrachtet werden können. Das wäre für mich der Forschungsanspruch, zumindest ein erster Schritt.
In meiner kleinen Arbeitsgruppe des zweiten Semesters „Liebesorte“ ist das immer wieder gelungen, bis dahin, dass Asly und Mavi nach dem Projekttag ein Plakat machten: „Vorher – Nachher“, um zu illustrieren, was sich durch das Forschen geändert hat (# mit meinem Methodentext).
Ähnlich würde ich die Fußballgruppe einschätzen. Die Rebellion der Mädchen gegen die männliche Besetzung von „Fußball“ führte dazu, dass sie sich selber, mit unserer Hilfe, ein Interview mit einer türkischen Fußballerin organisierten. Rund um das Machen der Homepage brachten sich einige Kinder in ihrer Freizeit verstärkt ein. Ich glaube das lag auch daran, dass es so etwas Konkretes war – eine Homepage machen. Aber auch hier rebellierten die Kinder immer wieder und forderten z.B. „Bezahlung“. Das verstanden wir jetzt nicht wörtlich (zu ihrem Leidwesen), aber sehr wohl als Einforderung das Folgende als ihre Erkenntnis, ihren Beitrag anzuerkennen: Was immer das war, wir haben hier gemeinsam ein Projekt gemacht und ohne uns hättet ihr das gar nicht können.
Konklusion
Unter partizipativ in diesem Kontext verstehe ich, dass Forscherinnen und Kinder gemeinsam „etwas wollen“ und in der Lage sind, Vorschläge zu machen und aufzugreifen. Dieses mein eigenes Denken darüber, was partizipatives Arbeiten ist oder sein könnte, hat sich im Tun geformt und konkretisiert und ist nun am Ende des Prozesses weniger von einem theoretischen/politischen/forschungsethischen Anspruch, denn von ganz konkreten Fragen getragen.
Ich denke daher auch, dass Partizipation sich dann am besten zeigt, wenn mensch nicht zu streng ist und nur wirklich von A-Z gemeinsam aufgesetzte Situationen als partizipativ denkt, sondern die ganz konkreten Ansätze sieht und weiterverfolgt: Wo können die Kinder, wir und die Lehrerin ein Stück weit auf die jeweiligen Ansprüche hören, eingehen, diese aufgreifen und verändern?
Dabei denke ich nicht, dass es dem partizipativen Gedanken widerspricht zu organisieren, strukturieren oder moderieren, wo es die Kinder (noch) nicht können – im besten Fall entwickelt sich daraus ein ‚learning by doing‘ und Einzelne übernehmen sukzessive die Tätigkeiten der Forscher_innen. Aber etwas an ihnen vorbei zu organisieren oder keine Freiräume für ihre Ideen zu lassen, wäre zumindest seltsam bis a-partizipativ. Genauso sind Vorgaben, Vorschläge, Setzungen und eigens geäußerte Interessen, die von uns kommen ein partizipativer Akt, so sie Anschlussstellen mit jenen der Kinder/Jugendlichen haben. Gerade im Gegenteil: Oft können von uns gemachte Vorschläge, Themen, Dinge den Prozess überhaupt erst ins Rollen bringen – zum Beispiel durch Gegenrede.
So schlage ich endlich vor, den gesamten Prozess der Ummodellierung unseres Antrages von „Wir gehen in ein Labor“ hin zu den Forschungsgruppen, die wir am Schluss hatten, als einen partizipativen Prozess zu verstehen, selbst wenn es uns in der konkreten Arbeit nicht so erscheinen konnte.