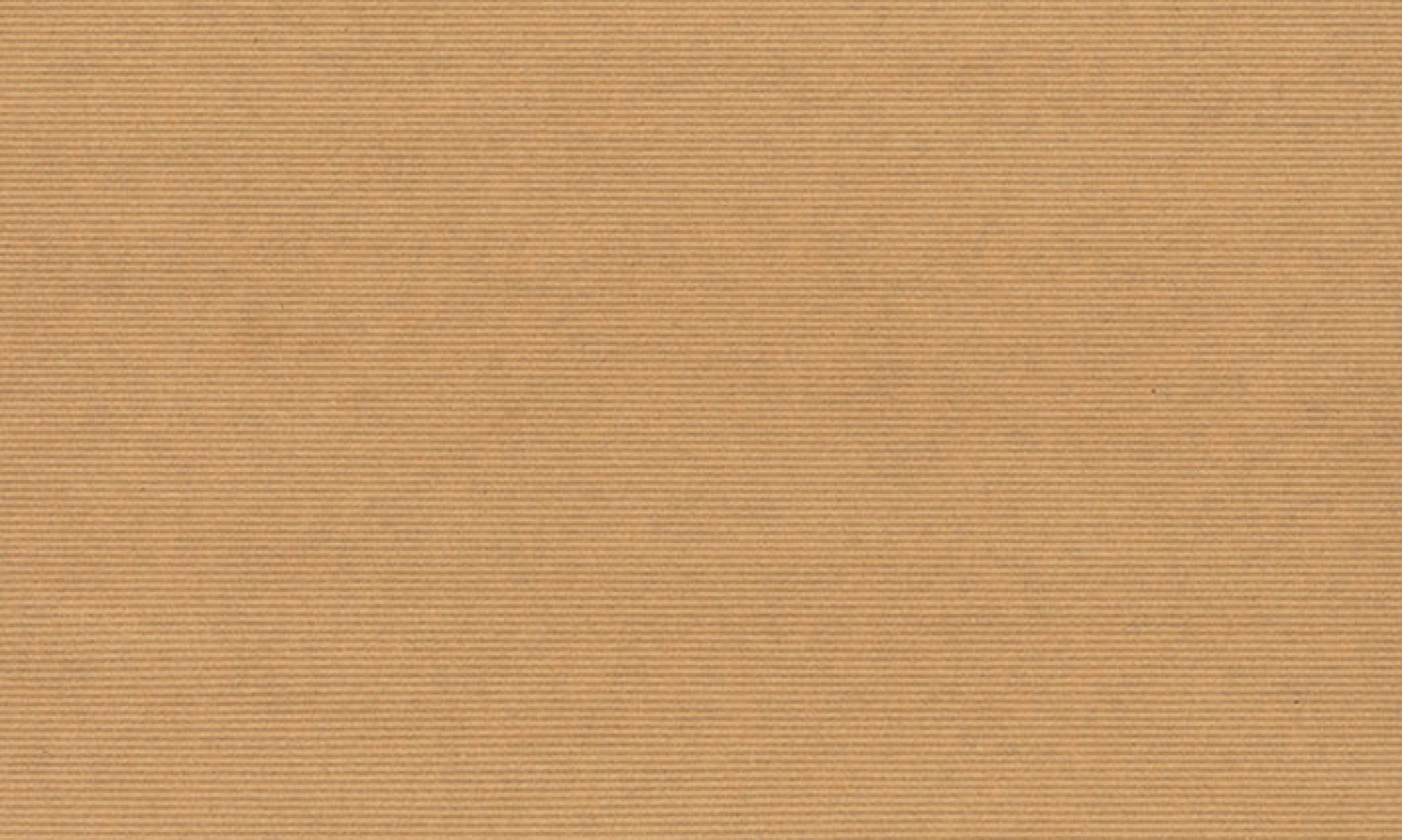Ja, mach nur einen Plan
sei nur ein großes Licht
und mach dann noch ’nen zweiten Plan
gehn tun sie beide nicht.
Bertolt Brecht, Dreigroschenoper
Partizipation ist politisch oder sie ist nicht.
Skizzengedanken von Karin Schneider
Achtung: Beim folgenden Text handelt es sich um ein Essay-Kommentar. Wissenschaftliche Analysen und exaktere Projektbeschreibungen finden sich hier unter den anderen „Texten zu Partizipation„, dem Projekt Hintergrund und den Wissenschaftlichen Texten
Ja mach nur einen Plan, oder wenn die Partizipation zu gallopieren beginnt. Das Vorwort.
Verlaufen die nächsten Tage so wie sie geplant sind (und das tun Tage oft nicht) dann wird auf dieser homepage eine Projektpräsentation in dem unabhängigen Fernsehkanal „OKTO“ (#link) zu sehen sein. (Reality check: ist der link gesetzt, ist der Plan aufgegangen, ist er nicht gesetzt, sein die Leser_innen frei zu spekulieren warum´s nicht geklappt hat und was wir alle daraus wohl für Schlüsse gezogen haben mögen – da sich dies alles jenseits der Projektlaufzeit abspielt wird es der Öffentlichkeit verborgen bleiben). Für „Okto“ ist dies nichts Besonderes, da die „Jungendredaktion“ partizipatives Fernsehen mit und für Jugendliche macht. Für ein „sparkling science“ Projekt wie unseres ist die Repräsentation in so einem Format ebenso nichts Besonderes, da der Anspruch einer öffentlichen Präsentation bereits im Antrag formuliert ist und von einer Förderungsschiene wie „sparkling science“ gewünscht wird. Unabhängiges Fernsehen und seine Jugendschiene und partizipative Forschungsförderung arbeiten sozusagen implizit Hand-in-Hand um die Figur der jugendlichen Forscher_innen fröhlich in Szene zu setzen (wer hat hier nicht gleich ein Bild von kleinen gescheit dreinblickenden Jungen oder Mädchen im Kopf, sie haben weiße Kittel an und blicken kritisch-entspannt auf ein Reagenzglas). Damit wäre der PR Auftrag eines solchen Projektes erfüllt. Unser Projekt hat, je nach Interpretation eine kleinen Haken oder einen kleinen Bonus: Es sind nicht die fröhlich wissenschaftstreibenden Nachwuchsakademiker_innen sondern Jugendliche, die unter dem Label „bildungsfern“ firmieren. Dieses, nicht besonders freundlich klingende label bekommen sie, weil ihre Eltern keine akademische Ausbildung haben, deutsch mit türkischem oder serbischen Akzent sprechen, Arbeiter oder Arbeiter_innen sind und auch weil sie Dinge nicht wissen, die es in Österreich zu wissen gilt (und andere Dinge wissen, zum Beispiel was in der Türkei viele Menschen über Kurden denken, was eine „Sure“ ist und wie das auf Arabisch geschrieben wird, wie es bei einer türkischen Hochzeit zugeht, wie es ist, von Bosnien just in Klagenfurt zu landen etc… das sie dies wissen, macht sie noch ferner dessen, was Österreicher_innen-Wissen ist. Über Bildung möge, so sagt es uns ein Plakat im Wiener Wahlkampf 2010 nur auf deutsch gesprochen werden). „Bildungsferne“ hat die Geografie schon im Namen. Die einen p.t. Leser_innen werden die Inklusion dieses Labels in ein „Sparkling Science Projekt“ nun als „Bonus“ sehen, wie einen Bonus-Track auf einer DVD, nicht nötig, nicht unbedingt im Fokus, eher überraschend, aber positiv. Die anderen werden skeptisch die Augenbraue zücken, denn das hätte mensch den „Bildungsfernen“ (die ja auch OKTO fern sind, Medienauftrittsfern, Jugend-forscht-fern) nicht zugetraut. Echt nicht. Und daher kann es sich dabei vermutlich nur um Manipulation unsererseits handeln (die Skepsis ist berechtigt, denn die andere Seite der Medaille des Ausschlusses „bildungsferner“ Migrant_innen-Kinder ist deren gutgemeinte Inszenierung als Beweis gelungener Integrationspolitik). Und außerdem ist der Nachweis, dass sie das können, die Bildungsfernen, auch damit nicht erbracht (dieser Satz ist ein freies, entkontextualisiertes Zitat aus einem der Projekt-Gutachten). Etc. Etc.
Das Besondere an diesem Plan für die nächsten Tage – OKTO Auftritt der drei die (selbsternannte) Homepageredaktion bildenden Jugendlichen – ist das tatsächlich nicht wir, die Forscher_innen sondern einer der dreien selbst diesen Auftritt wollte und organisierte. Überhaupt ist uns in der letzten Projektphase die Partizipation sozusagen „davongallopiert“ und hat sich selbst realisiert. Während wir, die professionellen Wissenschaftler_innen, mit Text-schreiben, Konferenzbeiträgen, papers, Gruppendynamik, (gescheiterten) Prozessanalysen,… beschäftigt waren, forderten zumindest drei der Jugendlichen ein, ihnen Räume und Zeit zu widmen, um an diesem, dem „gemeinsamen Projekt“ zu arbeiten und eine Homepage zu entwickeln, die zumindest annähernd von ihren Ideen geprägt sein solle. Sie forderten also uns zur Partizipation auf! Natürlich verwendeten sie anderes Vokabular, aber sie erinnerten uns daran, dass es doch ein gemeinsames Projekt sei, sie fühlten sich für dessen gelungenen Abschluss verantwortlich und auch für dessen Finanzierung. Eine Schülerin hatte zum Beispiel die Idee, falls es keine weitere Förderung geben sollte mittels Flohmarkt das Geld für die Präsentation der Homepage zu erwirtschaften. Sie waren sich gleichzeitig auch ihrer eigenen Position im Projekt bewusst, und begannen uns mit Gehaltsverhandlungen ganz schön in Verlegenheit zu bringen. Interessant war dabei aus meiner Sicht weniger, dass plötzlich einer von ihnen auf die Idee kam, einen Laptop zu wollen, sondern die Argumentationsweise, die sie öfter vorbrachten: Ohne ihre Teilhabe hätten wir nämlich gar kein Projekt mit Jugendlichen machen können und folglich auch keine Förderung dafür bekommen: Ohne sie hätten wir gar kein Projekt machen können, das sich partizipativ nennt. Damit haben sie eine der wichtigen unausgesprochenen Grundregeln partizipativer Projektpraxis durchschaut: Dass diese die Partizipierenden braucht um zu entstehen. Gleichzeitig haben sie sich diese Regel zu nutze gemacht und das Projekt nicht als passiv Teilhabende sondern als aktiv Selbstgestaltende beansprucht. Das von uns im Projektantrag formulierte „empowerment“ löste sich also ein, und zwar just in einer Projektphase, in der dies gar nicht mehr vorgesehen war. Ich gehe davon aus, dass es kein Zufall ist, an welchem Punkt das Projekt auch zu ihrem wurde. Mich beschäftigte diese Ungleichzeitigkeit, denn ich denke daraus ließen sich einige ganz brauchbare Gedanken ziehen. Diese letzte Phase war im vergleich zu allen anderen dadurch gekennzeichnet, dass ein ganz konkretes Ding – nämlich eine Homepage – fertig zu machen war. Die folgenden Thesen beruhen auf diesem Gedanken: Dass ein konkretes Tun etwas in Gang setzten konnte das dann in Richtung Reflexion des gesamten Prozesses führte. Meine Überlegungen beruhen auf der etwas wehmütigen Feststellung, dass wir diesem Bereich, der „Aktion“, weniger Bedeutung im übrigen Prozessverlauf zugemessen haben, als dies im Sinne der „Participatory Action Research“ (PAR) möglich gewesen wäre. Ich denke darüber nach, warum dies möglicher und berechtigter Weise der Fall gewesen sein mag. Ich unterstelle uns, den professionellen Forscher_innen eine Furcht vor der Aktion, die ebenfalls nicht unberechtigt ist und plädiere gleichzeitig dafür, diese im Sinne gelungener Partizipation zu überwinden oder mit Aktionsformen zu experimentieren. Ein solches Experiment ist ein politischer Akt, da er bewusst in Kauf nimmt neue Fakten zu schaffen. In diesem Fall die Tatsache, dass das Projekt auf OKTO vorgestellt werden wird, ohne dass wir, die professionellen Forscher_innnen das planten – so alles nach Plan läuft. Und das weiß mensch ja nie, wenn es um Partizipation geht.
Als Beispiel dienen mir jeweils einzelne Szenen aus den Forschungsgruppen, die ich im Projekt selbst betreute. Ich nehme mir in diesem Fall heraus, meine eigene Zögerlichkeiten zu benennen, zu kritisieren, zumindest auf der textuellen Ebenen zu korrigieren und andere Wege, die hätten gegangen werden können, vorzuschlagen.
Die Thesen
1. PAR ist pragramatisch naiv (und das kann dem kritischen Denken Probleme machen)
in dem Sinne, dass die PAR „Approach“ also die Haltung mit welcher PAR Forscher_innen ins Feld gehen oder aus dem Feld heraus sich zu Forscher_innen entwickeln eine ist, die so tut also ob sie nicht wüsste, dass NICHT alle forschen können weil nicht alle forschen dürfen, und die so tut als ob sie nicht wüsste, dass Probleme auf der Mikroebene zwar beobachtet nicht jedoch gelöst werden können. Im Gegenteil: PAR ist frisch, optimistisch und munter. In der Literatur finden sich Sätze wie „jeder/jede kann forschen“ (Lit XX). Ich bezeichne diese Haltung als „pragmatisch naiv“. Damit meine ich, dass ein solcher Forschungsansatz nicht grundsätzlich so naiv ist zu übersehen, dass es Disziplinierung und Professionalisierung gibt, die „bildungsferne“ Menschen aus der Produktion von Wissen ausschließen. Doch wird diese Einsicht probehalber, eben aus pragmatischen Gründen, ausgesetzt um eine Haltung der Gleichheit aller am Prozess Beteiligter zu entwickeln. Die Idee ist, dass nicht-professionelle Forscher_innen selbst neugierig und wissbegierig in Bezug auf ihre Lebensumwelt sind. Sie wissen bereits viel über ihr Umfeld , dieses Wissen kann und soll in der Forschung aufgegriffen werden. Den Ko-Forscher_innen wird zugesprochen selbst systematische Betrachtungen ihrer Lebenswelt anstellen und daraus neues Wissen generieren zu können. In einem weiteren Schritt bietet sich dann sehr wohl die Möglichkeit, über die Vorraussetzungen und Machtbeziehungen in dem jeweiligen Prozess nachzudenken. Möglicher Weise ergeben sich genau durch die zeit- und probeweise Neudefinition von Forschung als demokratischem Prozess neue Ansatzpunkte für Forschungs- und Wissenschaftskritik. Jedoch sei eingeräumt, dass eine solche Haltung die Gefahr beinhaltet, diesen folgenden Schritt zur Reflexion des eigenen Tuns zu vergessen und tatsächlich naiv zu werden.
Dies mag unsere Skepsis gegenüber dieser Haltung rechtfertigen:
Wir haben uns in diesem Projekt nicht immer mit Haut- und Haaren der „pragmatischen Naivität“ hingegeben, sondern in den Teamsitzungen unser eigenes Tun mit den Schüler_innen immer wieder kritisch befragt und auf mögliche „Alibihandlungen“ abgeklopft: Wollen wir den Kindern ein Bild von Forschung vermitteln, das so tut als ob Forschung demokratisch wäre? Wenn ja, was vermitteln wir da? Sollten wir nicht lieber die Ein- und Ausschlüsse von Forschung und Wissenschaft analysieren, die ja genau zum Ausschluss dieser Kinder/Jugendlichen (und auch der Lehrer_innen) aus der anerkannten Produktion von Wissen führen anstatt in kleinen, kleinen Mikroexperimenten die Machtstrukturen/Unterschiede scheinbar außer Kraft zu setzen und dadurch so zu tun als wären sie nicht? Und das führt zu These zwei
2. In einem Projekt wie diesem bleibt es oft unklar ob und was vermittelt werden soll
Tatsächlich gab es zeitweise unterschiedliche Meinungen darüber, ob wir vermitteln um zu forschen (meint: ohne gewisse methodisch didaktische Interventionen wie spielerisches Tun, Zeichnen, Filmschauen,… können Kinder wohl kaum als Datenlieferant_innen gewonnen werden, zumindest ist dies eine ziemlich weit verbreitete Vorannahme, die wir vermutlich auch unausgesprochen teilten), ob wir darüber forschen, wie wir vermitteln (also ob unsere eigenen Interventionen das eigentliche Thema im Sinne der Aktionsforschung sein müssten), ob wir vermitteln, wie wir forschen (also den Kindern ein Bild darüber geben wollen, was „Forschungskultur“ ist – mit all ihren Ausschlussmechanismen, Chaotismen, Krisen) oder vermitteln, wie SIE forschen können (im Sinne von: wie geht Interview machen, beobachten etc) und ob dies dann wieder auf einer Metaebene erforscht werden soll. Dadurch, dass wir nicht (immer) eindeutig entschieden waren, warum wir bestimmte Vermittlungsaktionen setzten (also um Daten zu gewinnen, um Inhalte zu transportieren oder um Mitarbeiter_innen an einem Forschungsprojekt zu gewinnen) konnten wir diese auch nicht immer klar setzen und konnten die wechselseitigen Bedingungen dieser unterschiedlichen Haltungen auch nicht zeigen. Dies ist aus meiner Sicht ein Widerspruch, der sich durch das gesamte „Sparkling Science“ Programm zieht – er ist nur in einem Projekt wie dem unseren explizit. Es bleibt eben unklar, ob in solchen Programmen die Jugendlichen tatsächlich zu Subjekten der Forschung werden und ob das Wissen, das sie auf diese Weise mit uns gemeinsam generieren ernst genommen wird. Sollen Jugendliche tatsächlich ihre eigenen Interessen und Forschungsfragen entwickeln können, so ist es notwendig noch einmal darüber nachzudenken, wie denn jemand die/der qua gesellschaftlicher Verhältnisse und Zuschreibung aus der Produktion von Wissen ausgeschlossen ist, zu einem Subjekt der Forschung werden kann.
Dafür ist es notwendig, zunächst einmal einen Schritt weg von der Frage was (oder wie oder ob) die Jugendlichen forschen können zu gehen und sich der Frage zu widmen, was die Jugendlichen machen wollen (eine aus unserem Team nannte es „der Vollzug im Realen“). Dass dieses „machen wollen“ eine Kraft (auch für die Produktion von neuen Erkenntnissen) erzeugen kann, habe ich einleitend versucht am Beispiel der Homepage und ihrer Präsentation auf OKTO zu zeigen (s.o.). Die Fokussierung auf das Tun als Epizentrum der Forschung führt zu
These 3:
3. bei PAR steht zwischen dem „P“ und dem „R“nicht zufällig das „A“
Viele qualitativ arbeitende Forschungsmethoden sind „partizipativ“ im Sinne des aktiven Involvierens der Forscher_innen in das Feld und im Sinne des aktiven Mitwirkens der Informant_innen: so ist teinehmende Beobachtung partizipativ, da die Forschenden sich dem Forschungsfeld aussetzen und jedes Interview erfordert die aktive Bereitschaft und Teilnahme seitens der Interviewten. Hier jedoch soll die Partizipation alle Teilnehmenden in ein konkretes Projekt involvieren (konkretes Projekt = Aktion=Praxis), dessen Erscheinungsform nicht mehr ausschließlich in der rein sprachlichen Ebene von Forschungsergebnissen darzustellen ist, sondern erlebt wird. Die PAR Seite „Research“ bezeichnet dabei auch eine über das gemeinsame Tun hinausgehende, dieses beforschende Komponente, die sich aber eng an die in dem Prozess eingeschlossene Aktion anbindet. „Research“ und „Participation“ machen in diesem Ansatz also nur einen Sinn, wenn sie die Action quasi umschleichen, umrahmen und sich aus ihr heraus definieren. Die Action im Sinne von PAR ist nicht einfach schlichtes Tun, sondern problembasiertes, lösungsorientiertes Tun. Die Probleme, für die eine Lösung gefunden werden soll, können Ausgangspunkt sein, sie können sich durch die gemeinsam geplante Aktion stellen (diese sogar verhindern), sie können auch in gemeinsamen Gesprächen auftauchen und dann in Praxis übersetzt werden. Beispiel: Im Rahmen der Enddiskussion der Forschungsgruppe „Liebesorte in der Schule“ formulierte eine Teilnehmerin, dass sie sich eine „Welt ohne Buben“ wünsche. Diese Formulierung erwuchs aus einer gemeinsamen Debatte und Analyse der Beobachtungsprotokolle (#link). Tatsächlich war hier das Semester und damit die kleine Forschungsgruppe zu Ende, das „Ergebnis“ blieb ein Plakat, also ausschließlich ein Textformat das dahinter stehende Begehren wurde nicht weiter verfolgt. Es hätte hier, bei einer Fokussierung auf die Aktion auch einen anderen Forschungsverlauf geben können: Aus der Phantasie „Welt ohne Buben“ (die ja auf basis ganz konkreter Gespräche über Erfahrungen dieses Mädchens in der Schule mit Buben formuliert wurde) könnte das Entwickeln von „Mädchen-Räumen“ in der Schule erwachsen und daraus das konkrete Projekt solche zu errichten und dafür alle notwendigen Schritte in Gang zu setzten. Im Sinne des # zyklischen Forschens kann eine weitere Phase genutzt werden, um das, was in der Schule möglich war und das, was nicht möglich war zu untersuchen. Meine These ist, dass die an diesem Prozess beteiligten Schüler_innen tatsächlich zu Subjekten einer solchen Forschungspraxis werden, da sich diese ganz konkret an eine von ihnen selbst gemachte Erfahrung anbindet. In derselben Forschungsgruppe tauchten Fragen nach Rassismus zwischen den Kindern auf, sie erzählten von Diskriminierungserfahrungen durch andere Kinder, weil sie Kopftuch tragen oder aus Romafamilien kommen. All diese Daten hätten in konkrete Aktionen überführt werden können um weiteres Material zu generieren, das zu bearbeiten wäre.
Ohne Problem keine PAR, denn PAR definiert sich ja dadurch, dass sie Sinn macht, weil es „ein Problem“ zu lösen gilt – wobei Problemverschiebungen ein Teil des Ansatzes sind, und „Lösungen“ auch im politischen Sinnen des Aufzeigens und forschenden Sinne des Durchdringens der Unlösbarkeit im System verstanden werden können.
4. Die „A“ erzeugt die Motivationsenergie – aber nur dann, wenn ihr Ziel NICHT darin besteht Motivationsenergie zu erzeugen
Die Action der PAR ist eines jener brauchbaren Element, das die Energie bereitstellt, die einzelne Nichtforscher_innen brauchen um sich so stark in die Forschung zu involvieren, dass das Projekt angeeignet wird. Ein gutes Beispiel ist für mich hier die Gestaltung der Homepage für jene Kinder, die in der Homepage und ihrer Existenz oder in einzelnen Subprojekten der Homepage ein eigenes Projekt gesehen haben, für das mensch verantwortlich ist. Nur etwas, das nicht per se Forschung ist, sondern die Notwendigkeit der Forschung nach sich zieht (z.B. dadurch dass sich am Weg dahin wo wir hinwollen Schwierigkeiten ergeben, dass die Strukturen sich als hartnäckiger erweisen als mensch am Anfang angenommen hat etc) bietet den Rahmen für Nicht-Forscherinnen sich als das was sie sind (nämlich als Nicht-Forscherinnen: als Schüler_innen, Lehrer_innen, Migrant_innen, Mädchen, Buben, Fußballer, Chater_innen,…) einzubringen und nicht Forscher_innen zu spielen – ein Spiel, das ohnehin jeder/jede gleich durchschaut. Der Witz ist, dass dadurch, dass eine gemeinsame Basis geschaffen wird, tatsächlich alle zu Forscher_innen werden können.
Es ergibt sich die Motivationsenergie WEIL eine Action im Sinne der PAR nicht aus der Notwendigkeit entsteht, Motivationsenergie zu erzeugen, sondern aus einer tatsächlichen Notwendigkeit des Über/lebens der Beteiligten: Wir wollen das tun! (Weil wir es brauchen) Wie tun wir das? Wer verhindert es? Wer sind unsere Partner_innen? Was geht, was nicht? Wo versperren Strukturen den Weg, Institutionen, Einzelne? Wie wirken Strukturen etc… Anders als in vielen pädagogischen Projekten sind die Fragen nicht von Wissenden entwickelt, damit andere das lernen, was sie bereits wissen, sondern tauchen die Forschungsfragen in einem Prozess auf, der für alle Beteiligten – Schüler_innen, Forscher_innen, Lehrer_innen – unbekanntes Land ist und in dem alle Getriebene sind.
5. In einem PAR-Projekt generiert die „A“ die Daten – aber nur dann, wenn ihr Ziel NICHT darin besteht, Daten zu generieren
Die PAR- Action ist eine Situation in der Daten darüber gewonnen werden können, wo die Grenzen des Machbaren auch innerhalb des Systems „Forschung“ liegen. Eine Action wie oben beschrieben entsteht aber erst und genau an dem Moment, wo ihr Ziel NICHT darin besteht, Daten zu generieren, sondern einen Misstand zu lösen oder auch ein gemeinsames Ding zu erzeugen. Meine These ist, dass ohne eine gemeinsam entwickelte und ernsthaft durchgeführte Action (wie die Präsentation der Homepage im Fernsehen) zu der Frage von Machbarkeit/Grenzen von Machbaren mit diesen konkreten Jugendlichen gar keine Daten gewonnen werden können.
Im Sinne von Rancier ist die „A“ etwas, das Gleiche konstituiert, da es eine Gleichheit in Bezug auf das außerhalb beider Kontexte (des Schulischen und des Forschenden) gibt. So ist die Homepage eine „dritte Sache“, von der weder die Schüler_innen noch die Lehrer_innen oder die Forscher_inne wissen, wie es geht. Es verwundert mich nicht, dass genau hier ein Moment entstand, an dem es den Schüler_inne möglich wurde, sich als Gleiche, als Lohn für ihre Arbeit einfordernde Verhandlungspartner_innen zu setzen.
6. Partizipation ist politisch – oder sie ist nicht.
Der Vorwurf an die PAR, mit dem naiven Mief der 1970er Jahre umwoben, Forschung für Politik zu instrumentalisieren, kann auch ins Positive gekehrt werden, wenn es darum geht, den Partizipations-Gedanken vom Mief des neoliberalen Zugriffs der 1990er und 2010er Jahre zu „befreien“: Das politische Moment der PAR ist tatsächlich jenes Moment, an dem Partizipation im Sinnen des „zusammen-mit“ erscheinen kann. Der Auftrag zu partizipieren ruft nun nun die Mitmachenden weder als Schüler_innen an (die durch partizipative Angebote einfach besser lernen würden) noch als Datenlieferant_innen für die Forschung (die durch partizipative Angebote bereitwilliger Auskunft erteilen). Die Subjekte werden vielmehr als Handelnde in einem Kontext konstituiert, in dem „Veränderung denken“ ein gemeinsames Anliegen werden kann, das alle gleichermaßen aufwühlt wie es allen gleichermaßen schwer fällt, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen und Hintergründen. Das türkische Mädchen, das sich eine „Welt ohne Männer“ erträumte, die jugendliche Romni, die im Postulat dass „wir alle Menschen sind“ eine Möglichkeit sieht, dem gegen sie gerichtetem Rassismus die Stirne zu bieten oder der tschetschenische Junge, der sich über die Körperhaltungen armer Menschen Gedanken machte… Meine Beispiele haben hoffentlich auch klar gemacht, dass ich unter „Action“ auch das Denken und das Beobachten, das Wünschen oder das Aussprechen verstehe. Die politische Wendung der PAR könnte so als Möglichkeit verstanden und angeeignet werden, Partizipation von einer Behauptung zu einer Notwendigkeit zu machen, da sich das politische Moment über eine Kollektivität definiert die jenseits des beauftragten Projekts liegt. Dass ich am „Fuße des Projektendes“, ohne Folgeauftrag mitten in der Nacht diesem Text abermals eine neue Wende gebe, hat etwas damit zutun: Ich bin Getrieben. Getrieben nicht von Abgabeterminen (die habe ich ohnehin schon lange überzogen), sondern von Plakaten des Wiener Wahlkampfes, die auffordern über „Bildung am besten auf Deutsch“ nachzudenken, oder die „freien Frauen“ gegen den Islam mit seinem „Kopftuchzwang“ zu verteidigen, von öffentlichen Statements, die gegen Migration ganz allgemein Stimmung und Islamophobie salonfähig machen, getrieben auch von den Ausweisungen der Roma aus zentraleuropäischen Ländern gerade eben erst. Meine Lebenswelt und die der Kinder haben so dadurch? etwas Gemeinsames, das aus der engen Logik von Forschungsprojekten und Schulrealität hinausweist. Dadurch, dass die Aktion als politischer Akt verstanden wird, ist auch nachvollziehbar, dass unterschiedliche Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen und Motivgründen hier anschieben, um ein gemeinsames Ding in Gang zu setzten oder zu verhindern. So könnte das reale Konstituieren von eigenen Mädchenräumen in der Schule (erwachsen aus Aslys „Welt ohne Buben“) für die Mädchen schlicht bedeuten, dass sie unser Projekt nutzen, ihre Räume zu bekommen und zu entwickeln, für die Lehrer_in, dass sie überhaupt in Verhandlungen über mehr Raum an der Schule für ihre Arbeit treten kann, für die Buben eigene Forderungen nach „mehr Platz für Jungs“ in Gestalt zu bringen, für die Forscher_innen zu testen, in wie weit feministische Thesen in diesem Kontext funktionieren und sich verändern.
7. Es gibt gute Gründe, keine PAR machen zu wollen. Dennoch…
Der Grund warum wir an soviel möglichen Stellen im Projekt nicht ins gemeinsame Handeln kamen, ja das gar nicht andachten oder versuchten lag vermutlich darin, dass wir nicht „programmatisch naiv“ sind oder sein wollten. Wir wollten gute Forschung machen im Sinne von sorgfältiger Grundlagenforschung, keine Vorgabe der Themen durch die Politik, keine pragmatische Problem- und Lösungsfokussierung. Das allerdings sind jedoch auch Forschungshaltungen, die sich nicht besonders gut dafür eigenen, die außerhalb der Forschung stehenden zu inkludieren, wenn sie nicht selbst bereits diese reflexiven Haltungen für sich und ihr Leben in Anspruch genommen haben. Aber selbst dann ist das Reflektieren ein Hase- und Igel spiel: Wir, die wir wissen, wie es geht sind immer schon da (gewesen), zumindest ab dem Moment, wo die eigentlichen Ergebnisse sichtbar werden, denn die liegen immer außerhalb der Themen, die wir mit ihnen durchspielten; so ein Text (und er kann noch so kritisch sein) wird immer unter Ausschluss jener geschrieben werden, die partizipatorisch einbezogen waren. Dies ist ein Widerspruch, den Grundlagenforschung schon aushalten kann und muss (ich habe ja nicht verzichtet darauf den Text zu schreiben), wenn jedoch alle Ergebnisse oder Aktivitäten rund um die Sichtbarmachung von gemeinsamer Forschung so kodiert durchgeführt werden, dass nur die geschulte Forschungscommunity damit umgehen kann, dann reproduzieren wir möglicher Weise genau jene Ausschlüsse über die wir auf der Theoriebene kritisch reflektieren. Geht es dabei um Rassismus und um herkunftsbezogene Ausgrenzung so ist dies auch eine problematische Haltung des Forschungsansatzes, da dieser eine den Rassimsmus reproduzierende Subjekt (= Forscher_in = Weiß) Objekt (= Beforschte = von Rassismus betroffene) Trennung weiterschreibt.
Zum Abschluss also: Wir waren immer wieder und länger als wir dachten „partizipativ“ in unserem Projekt. Darüber brauchen wir uns nicht zu sorgen. Doch de facto her waren wir an vielen Stellen nicht partizipativer als dies in anderen Schulforschungsprojekten notwendig gewesen wäre, um überhaupt zu forschen – vielleicht mit etwas mehr Aufwand und etwas mehr (durchaus nicht zu unterschätzendem) Output und Benefit für einzelne Schüler_innen. Um weiter zu gehen, hätten wir ein „A“ im Sinne des oben skizzierten Approaches gebraucht. Dass wir diese vermieden, hat auch gute forschungspolitische Gründe (der Nicht-Instrumentalisierbarkeit z.B.), aber das eine ist ohne das andere nicht zu haben.
8. PS
So hätte ich geendet. Nun haben aber drei der Jugendliche sich zu einer Homepage – Projektgruppe definiert; sie rufen uns an, machen Termine aus, stellen Gehaltsforderungen, reflektieren die Projektlogik und die Grenzen des Machbaren, leiden mit uns am Ausbleiben des Folgeantrages und überlegen andere Mittel, um Geld aufzustellen, rufen das OKTO TV an, um einen Sendeplatz zu bekommen –
Und das alles ohne sich darum zu kümmern, ob wir alles richtig gemacht haben, was wir hätten machen müssen, um ein wirklich partizipatives Projekt in Gang zu setzen.